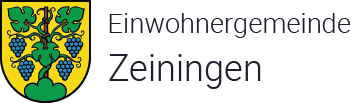Das Erkanthnus büchlin von Zeiningen, 1739 - 1850
Die Marchleute waren ohne Ausnahme Laienrichter. Das Volk misst ihnen immer noch eher mehr Sachkenntnis zu als den „Studierten“, etwa so, wie es den „Bücherbauern“ gelegentlich mitleidig belächelt. (…) Der schiedsrichterliche Charakter der Marchgerichte ist ein weiterer wichtiger Punkt, der im Auge zu behalten ist beim Studium der Urkunden von der Art der Erkanntnus-Büchlein. Weil der Spruch der „March“ meistens aus ungeschriebenem Gewohnheitsrecht geschöpft wird, schafft er auch nie oder höchst selten neues Recht; er legt nur Recht fest von Fall zu Fall. (…) Zu den allgemeinen Vorbemerkungen ist nachzutragen, dass bei dem früher herrschenden „Kollegialsystem“ der Beamtungen jeder Funktionär das Archiv seines Ressorts zu Hause hatte. Manches kostbare Stück ist so den Feuersbrünsten, die ganze Dorfteile, sogar ganze Dörfer hinwegfegten, zum Opfer gefallen; anderes galt vielleicht als Familienerbstück, bis es einmal mit anderem „Plunder“ aus dem Wege geschafft wurde. Als um 1800 die grosse „Erneuerung“ für unsere Dörfer kam, hätten die Gemeindebehörden zwar ihre Archive zentralisieren können. Warum sie das nur in den seltenen Fällen in unseren Gegenden taten, begreifen wir, wenn wir uns an die materielle Notlage des Volkes zur Franzosenzeit erinnern und an die stürmische Zeit des „Kantons Fricktal“. Man hatte vorläufig Wichtigeres zu besorgen, als alte Papiere zu pflegen und Siegel nach ihrem historischen Werte aufzuheben; die Gegenwart mit ihrer Zukunftssorge ging jedem über die Zeugen der Vergangenheit, und an althergekommenen Rechten und Gewohnheiten ändere sich tatsächlich nicht vieles, (….).
Über die Vernichtung des alten und die Erstellung des neuen „Büchleins“ berichtet die erste Seite: „Zeining 1740 den 15 Dag mertzen ist disz Erkanthnus büchli Erkannth worten weillen dass Alte büchli den 16 hornung auch 1740 in dess benetict wunderlins hauss auff Einem himmeleth bet laden gelegen und in selbiger leintiger feürs brunnst ist verbrenndt worten was mit (nit?) lang dar vor seint Er kannthnus geschehen dass die Er samen Er kannthnus manen noch wohll ge wust haben hatt man doch wiederumb in dass buoch hinein ge schrieben.“
Nachfolgend einige „originelle“ Beispiele aus diesem Büchlein:
„1739 den ersten Tag Herbstmonat klagen Heinrich Hollinger und Joseph Merz gegen Dominicus Jeck. Dieser hat einen Weg gebaut durch seines Tochtermanns Matte hinauf und oben dem Wassergraben entlang „welches denen fröumbten leuthen und denen heimischen ser mis bellig“. Auf Befehl des Stabhalters haben dann 4 unparteiische Männer einen Augenschein eingenommen und erkannt, „dass der Dom. Jegg (Jeck) und sein tochter Man solle den wegg ganz bar lassen wo zuo vor an Er denklichen Jahren heer gewessen ist.“
„1741 den 6 dagg herbst mont so haben die Er samen march leüth oufr be Glagen Jaccob brogli wider Jaccob Urben einen augenschein ein ge nommen wegen Einem Nuss baum“ an des Broglis Haus. Das Marchgericht teilt die Befürchtungen des Klägers: Wenn der Nuss-baum zu Jahren kommen sollte, so täte er des Jacob Br. Haus einen grossen Schaden. Ist also erkannt worden, „dass der nus boum sollte hein wegg getohn weerten und Keinen anderen dort hinn pflantz weerten.“
„1749, 22. April: Des „wagner Joseben tochter ein arme widib“ (veralteter Ausdruck für Witwe, Anm. Zeguhe) klagt, dass ihre oberen Anstösser Sebastian Wunderli und Fridli Bider ihr bisheriges Ackerland zu Matten gemacht haben und bei deren Bewässerung „dass wasser zuo samen gelouffen, hatt Ihren einen grossen schaden Zuo gefüegt.“ Ist erkannt worden, dass die beklagten Anstösser einen Graben machen sollen zwischen der Witfrauen und ihrem Land, dann das Wasser „überzwerch“ in die alte Landstrasse nach der Brücke hin leiten und „der W. Ihren ackher sicher sein solle“. Ferner sollen W. u. B. „den graben so dass wasser auffgefressen in Yhren eigenen Cösten Einn machen lassen und der witib den schaden Ver bessern so sie gehabt. NB. ist Zuo wüssen weillen die wittib viell von yhrem ackher ver lohren wegen der neüwen landstrass so solle sie yetz Vonn der alten lannd strass 6 werch schuo (Schuh, Anm. Zeguhe) Zub nutzen haben so lang (weit) dass yhren ackher sich Er reichen Thuot.“
„1749, 25. August. Hans Grember, der Weber, hat in seinem Gärtlein 4 Fruchtbäume. Darunter befindet sich ein grosser Nussbaum, welcher indessen nicht in Streit steht, da der Kläger Küentze Wunderli davon nach Ansicht der Richter das „Anries“ (Kapprecht, Anm. Zeguhe) bekommen. Hingegen erweist es sich, dass die „2 birbeum und 1 öbfell baum dem C.W. grossen Schaten an seinem ackher Zuo füegen weillen es gar wenig frücht gibt so weid die eest auff des C.S. ackher hangen.“ Wenn nun der Beklagte dem Kläger das rechtmässige Anries nicht geben wollte, so solle der Hs. Gr. selbige Aeste am Stamm abhauen.
1756, 31. Oktober: „so ist die ganze burgerschaft zue Z(einingen) Klaghaft gewesen wegen dem wasser so. ab dem berg hinund komen und durch die Juch gass Hin Eingeloffen dass der weg ist dergestalten ist angefressen worden und der gemeyn ein grosser schaden geschehen ist.“
Beschluss: das Wasser sei in mehrere Gräben zu verteilen und zur Regelung seien 3 Brütschen (Falltüre an einer Schleuse) einzuschlagen.
„1758, 10. April. Lorenz und Jacob Lang wünschten eine Schätzung ihres Häusleins durch die March. Ergebnis: 150 Gulden. Anstöss: liegt in der Leimgass, dem gemeinen Weg, anderseits (gegenüber) Caspar Schmit, obs. (oberhalb) Jos. Gasser, nids. (unterhalb) Anton Wunderli, der Hirte
1769, 7. Juni. Spruch auf Befehl der „gnedigsten Herrschaft“: die streitenden Parteien sollen „dass wesserli“ abwechlungsweise je 8 und 14 Tage ununterbrochen zur Wässerung benutzen.
„1770: bei Grabenöffnung soll keiner dem andern den grundt hin wegnehmen“.
„1776: nachbarlicher Streit wegen Nussbaum. W. ist der Witwe K. den halben Teil der Nüsse zu geben schuldig, oder dass tolder, so auf ihrenseiten hangt (soll) ihr allein zugehören. Sollte aber der Baum abgethuon werden so solle Einem Jeden das halbe holtz gehören.“
„1784, IV. 10. Fussweg oder Karrenweg? „Es soll der küeffer (Battist Jeck) keinen Karrenweg schuldig sein als Just in der brachzeit wie ander burger auch auf sich müessen gefallen lassen über ihre Acker zu fahren. Hiemit ist vor Recht erkannt … dass der küeffer nur ein Fussweg müsse Ligen lassen: wie allzeit ist gebräuchlich gewesen.“
„1809 V. 20. Auf einer Scheune haftete ein altes Wegrecht zum Wäscheplatz am Bache. Der Weg soll künftig durch den Grasgarten des Scheunenbesitzers bis zum Bache gehen.“