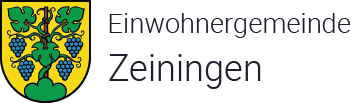Erster Weltkrieg, 1914 - 1918
Notleidende Bevölkerung
Nach dem überraschenden europäischen Kriegsausbruch ordnete der Bundesrat auf den 3. August 1914 die Kriegsmobilmachung an und die Bundesversammlung wählte Ulrich Wille zum General. Er genoss in der stark auf Deutschland ausgerichteten Deutschschweiz und im Aargau grosse Sympathien. Akademiker hatten überwiegend an deutschen Universitäten studiert, zum Beispiel drei von fünf der 1914 -1918 amtierenden Aargauer Regierungsräte. Hochdeutsch zu sprechen gehörte nicht nur bei der Zürcher Oberschicht zum guten Ton. Ferner wohnten viele Deutsche in der Deutschschweiz, im Aargau waren es um 1910 9531 Personen oder vier Prozent der Gesamtbevölkerung (eingebürgerte Deutsche nicht eingerechnet). Die Welschen sympathisierten dagegen vorwiegend mit Frankreich, dem Kriegsgegner Deutschlands, und standen dem mehrheitlich deutschfreundlichen Bundesrat und der Armeeleitung äusserst skeptisch gegenüber. Ein Graben zwischen Deutsch und Welsch tat sich auf. Die auf den Krieg völlig unvorbereitete Zivilbevölkerung zog panikartig ihre Guthaben von den Banken zurück und leerte mit Hamsterkäufen die Regale der Lebensmittelgeschäfte. Das Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage im Lebensmittelsektor führte zu drastischen Preiserhöhungen. Vor allem Arbeitnehmer und Rentner waren betroffen. Hingegen profitierten die meisten Landwirte, da sie ihre Produkte teuer verkaufen konnten. Die bescheidenen Massnahmen des Bundesrats zur Preiskontrolle zeitigten keine besondere Wirkung. Der schweizerische Bauernverband mit Sitz in Brugg verwahrte sich energisch gegen die Preisbindung für landwirtschaftliche Produkte, besonders gegen die Festsetzung des Milchpreises durch den Bund. Das erste Kriegsjahr brachte einen starken Rückgang der industriellen Produktion, verbunden mit Lohnkürzungen und Massenentlassungen. Durch die teilweise Umstellung der Produktion auf Rüstungsgüter normalisierte sich der Geschäftsgang in vielen Bereichen. Manche Betriebe erlebten sogar eine Blütezeit. Die Lohnaufbesserungen hielten allerdings mit der Teuerung nicht Schritt. Besonders betroffen waren die Arbeiter. Sie verdienten 1917 real über ein Viertel weniger als 1914. Trotz vieler privater und öffentlicher Hilfsprogramme verschärfte sich die materielle Notlage stetig und mündete in Unzufriedenheit und soziale Unrast (Quelle: allg. Geschichte).
Radikalisierung und drohender Bürgerkrieg
Unter dem Eindruck der Kriegsgreuel und der um sich greifenden Not rief die sozialistische Jugendbewegung bereits auf den 3. September 1916 zu Demonstrationen gegen Krieg und Militarismus auf. In der ganzen Schweiz fanden an diesem Tag 139 Demonstrationen statt, wovon ein Dutzend im Aargau. Allein 700 Teilnehmer besuchten die Kundgebung in Aarau. Ein gesamtschweizerischer, halbtägiger Warnstreik am 30. August 1917, den die Sozialdemokratische Partei der Schweiz zusammen mit dem Gewerkschaftsbund organisierte, wirkte sich auch im Aargau aus: 2000 Demonstranten in Aarau, 3500 in Baden und 1000 in Brugg. Ob und wie viele Zeininger dabei waren ist nicht aktenkundig. ...........(Quelle: allg. Geschichte).
Die Situation im Fricktal und in Zeiningen
(Quelle: Linus Hüsser, Historiker, Ueken / Aargauer Zeitung vom 24.1.14) „Trotz der Neutralität der Schweiz hatte der Beginn des Ersten Weltkriegs für das Fricktal (und für Zeiningen, Anm. Zeguhe) Folgen. Die Grenze am Rhein wurde zur Bedrohung, die Brücken wurden verbarrikadiert und die vierjährige Grenzbesetzung trieb die Lebensmittelpreise in die Höhe. Wie der Alltag zwischen 1914 und 1918 hier genau ausgesehen hat, ist heute schwierig zu rekonstruieren. Zeitzeugen, die sich erinnern könnten, leben keine mehr. Laut Hüsser wurden 220‘000 Schweizer Männer damals in den Aktivdienst eingezogen. Der Grossteil der Aargauer Truppen musste am 4. August 1914 im Aarauer Schachen einrücken. Von da aus verschoben sich die Einheiten über die Jurapässe, um die Grenzabschnitte im Solothurner Jura, im Baselbiet und am Hochrhein zu bewachen. Am selben Tag marschierten deutsche Truppen ohne Kriegserklärung in das neutrale Belgien ein, um von dort aus Frankreich anzugreifen.
Die neutrale Schweiz wurde in den Kriegsjahren vor militärischen Kampfhandlungen verschont. Die Bevölkerung litt gleichwohl unter den verheerenden Auseinandersetzungen in Europa. Das Fricktal war mit seiner Lage hautnah dran am Kriegstreiben. Der Geschützlärm aus dem nahen Frankreich war an manchen Tagen gut zu hören. Eine mögliche, aber kaum erwartete Bedrohung war, dass deutsche Truppen durch Schweizer Gebiet nach Frankreich vorstossen würden, wie es auch in Belgien geschehen war. Für die Bewohner der Nordwestschweiz gab es aber zunächst wenig Grund zur Sorge.“
Deutschfreundliche Gesinnung - der Kriegsausbruch 1914
Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajewo eskalierte Ende Juli die angespannte politische Situation in Europa. Deutschland erklärte - als Verbündete Österreich-Ungarns - Russland und Frankreich den Krieg. Am 1. August beschloss der Schweizer Bundesrat die allgemeine Mobilmachung. (....).
Linus Hüsser, profunder Kenner der Fricktaler Geschichte, erklärt: «Die Deutschschweizer waren im Gegensatz zu den Welschen mehrheitlich deutschfreundlich gesinnt und vertrauten auf einen raschen Sieg Deutschlands. Die gebildete Oberschicht studierte bis dahin vorwiegend an deutschen Universitäten, Hochdeutsch galt bei uns als vornehm und gehörte zum guten Ton in weiten Teilen der Bevölkerung.»
Die grösste Angst der Schweizer war eine Nahrungsmittelknappheit. Die Lebensmittelgeschäfte wurden in den ersten Kriegstagen regelrecht gestürmt. Die Behörden riefen zu massvollem Konsum auf und ordneten an, Lebensmittel nur noch in kleinen Mengen auszugeben. Durch die Hamsterkäufe sank das Angebot schlagartig, was drastische Preiserhöhungen auslöste. Die Grenze am Rhein wurde streng bewacht. Hüsser sagt dazu: «Befestigungsanlagen wie im Zweiten Weltkrieg gab es keine. Vor allem zu Beginn des Krieges waren aber grosse Truppenkontingente am Rhein stationiert.»
Hüsser weiss von einer Kavalleriebrigade, die im Sisslerfeld grosse Schäden anrichtete. Die Schadensumme belief sich allein in der Gemeinde Münchwilen auf über 300 Franken, damals viel Geld. Die Grenzbesetzung konzentrierte sich auf besonders exponierte Stellen, insbesondere die Brücken in Laufenburg, Stein und Rheinfelden sowie die Kraftwerke Laufenburg und Rheinfelden mit ihren Flussübergängen.
Weite Teile des oberen und unteren Fricktals waren seit Jahrhunderten dem Stift Säckingen zugehörig. Für einige Gemeinden bedeutete der Erste Weltkrieg wirtschaftlich eine Katastrophe. In Säckingen standen Textilfabriken, die von Schweizer Fabrikanten gegründet worden waren und Hunderte Fricktaler in Lohn und Brot hielten. Um 1910 pendelten bis zu 1500 Arbeiter über den Rhein. Man ging aber nicht nur zum Arbeiten «i d’Stadt ie», sondern auch zum Einkaufen in die Geschäfte und auf die Wochenmärkte.
Trotz der verschiedenen politischen Systeme wurden in dieser Zeit viele gesellschaftliche Beziehungen geknüpft. Gelegentliche Reibereien mit der preussischen Regierung taten dem guten Einvernehmen keinen Abbruch. Die Fricktaler waren ein ganz selbstverständlicher Teil des kulturellen, religiösen und wirtschaftlichen Lebens in der Fridolinsstadt. Zahlreiche Schweizer wohnten im Badischen, und mancher Fricktaler holte sich am gemeinsamen Fest der katholischen Bevölkerung links und rechts des Rheins, am Fridolinsfest in Säckingen, ein „Wälderwybli“ aus dem Hotzenwald . (Quelle: „Vom Jura zum Schwarzwald“, 1989). Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts halfen Hotzenwälder Mäher im Fricktal bei der Heuernte, da in den höheren Lagen des Hotzenwalds das Heu später schnittreif war als im Rheintal, so Hüsser. «Man heiratete über die Grenze hinweg und hatte Verwandte hüben und drüben.»
Diese engen Beziehungen wurden mit der Grenzschliessung 1914 jäh unterbrochen. Die Angestellten der Textilfabriken im Badischen spürten die Auswirkungen des Krieges als Erste. Sie konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen und wurden entlassen.
Für den Kurort Rheinfelden bedeutete die Kriegszeit einen markanten Einbruch. Die Solbäder, allen voran das Grand Hôtel des Salines au Parc, wo bis zum Krieg Besucher aus ganz Europa kurten, hatten plötzlich keine internationalen Gäste mehr und damit grosse wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ausgeglichen wurden diese Verluste mit der Bewirtschaftung inländischer Gäste. Auch hohe Militärs stiegen in Rheinfelder Hotels ab, General Wille etwa logierte im «Schiff». Statt Englisch und Französisch hörte man bald nur noch Schweizerdeutsch in Rheinfeldens Strassen und Gassen.
Weil wegen der Einberufung an allen Orten Personal fehlte, war die Stromproduktion im Rheinfelder Kraftwerk zeitweise kurz vor der Einstellung. Brisant wurde es für das grenzüberschreitende Elektrizitätswerk im Oktober 1916. Ein französisch-schweizerischer Spionagering verübte einen Bombenanschlag auf die Anlage, der glücklicherweise scheiterte. Nicht zuletzt, weil die kriegswichtigen elektro-chemischen Unternehmen in Badisch-Rheinfelden viel Strom benötigten, wurde das Kraftwerk auf beiden Seiten besonders gut bewacht und behütet.
Die beiden Rheinfelder Brauereien Salmen und Feldschlösschen hatten grosse Schwierigkeiten, teures Malz zu beschaffen und brauten dünneres Bier, was den Konsumenten gar nicht schmeckte und den Bierbrauern herbe Verluste bescherte.
Hunger und Spanische Grippe
Das Leben war in Zeiningen nicht einfach. Die Bevölkerung musste das Militär mit Lebensmitteln und mit Heu und Stroh für die Pferde versorgen.
Gegen Ende des Krieges wurde die Versorgungslage in den grösseren Schweizer Städten immer prekärer. Als Gegenmassnahme wurde der Kartoffelanbau vom Schweizerischen Bauernverband in Brugg aktiv gefördert. Eine Weisung ordnete im April 1918 die Lieferung eines ganzen Eisenbahnwagens Kartoffeln aus den Dörfern Münchwilen, Eiken, Sisseln und Schupfart in die Stadt Zürich an, wie ein Münchwiler Gemeinderatsprotokoll zeigt. Lebensmittel wurden zunehmend rationiert, der Kanton Aargau gab Lebensmittelmarken für die Grundnahrungsmittel aus. Der Kaffeepreis stieg von 1914 bis 1918 um 71 Prozent, der Preis für Schweineschmalz um 271 Prozent, gelbe Erbsen kosteten am Ende des Krieges gar das Fünffache. Die Preise stiegen in den letzten Kriegsjahren stärker an als die Löhne. Viel zu spät wurden erst im März 1917 nicht nur Brot, Mehl, Teigwaren und Kartoffeln, sondern auch Zucker, Öl, Fett, Milch, Käse und Butter rationiert.
1918 kam zu den wirtschaftlichen Problemen eine aussergewöhnlich heftige Grippewelle – die Spanische Grippe – hinzu, die auch im Fricktal Dutzende Tote forderte. Unter den Soldaten grassierte die Epidemie. Bis 1920 dauerte die Grippewelle an, zahlreiche gesellschaftliche Anlässe wurden wegen der Ansteckungsgefahr verboten.
Ein Ende mit Schrecken
Am Ende des Krieges im November 1918 kam es zu grossen sozialen Unruhen. In Europa tobten die Novemberrevolutionen, die Schweiz erlebte den Landesstreik. Die Arbeiterschaft erkämpfte sich in diesem kurzen, heftigen Aufbegehren ein Fabrikgesetz und damit bessere Arbeitsbedingungen.
Im Fricktal hatten die vier Jahre der Grenzbesetzung grosse wirtschaftliche Nöte und Sorgen hinterlassen. Besonders schwer wogen die Verdienstausfälle der eingezogenen Wehrmänner. Bis zu 500 Diensttage hatte ein Soldat zu leisten. Verdienstausfallsentschädigung gab es damals noch keine, der Sold war sehr gering.
Viele Familien trieb das in die Armut. Vor noch grösserem Unglück blieb das Fricktal verschont. Grenzübergänge und Lebensmitteltransporte über die Rheinbrücken waren bis 1921 streng reglementiert. Die Beziehungen zwischen den Fricktalern und ihren badischen Nachbarn normalisierten sich rasch – bevor zwanzig Jahre später ein erneuter Krieg die Grenze zur Bedrohung machte.
Die 2 folgenden Auszüge aus Aufsätzen von Johann Freiermuth, Zeininger Pädagogik-Student am Konvikt in Zug, von 1915 und 1916, schildern die Zustände und Ereignisse der damaligen Zeit eindrücklich:
„Krieg donnert es durch die Lande Europas. Furchtbar wälzt sich der vernichtende Brand über die Gaue dahin. Nichts lässt er zurück als Tod und Verderben, Armut und Not. Da mitten in diesem Feld des Grauens steht wie eine blühende Rose auf dürrem Wüstensand die Schweiz, unser Vaterland. Friedensduft strahlt sie aus, dass die lodernden Kriegsflammen scheu vor ihr zurückweichen, und sie dasteht schön und erhaben, als eine Insel des Friedens und der Ruhe. – Ja wir Schweizer sind dennoch glücklich, wenn uns der umtobende Krieg auch schon vielen Schaden und manche Unannehmlichkeiten gebracht hat. Wenn wir unser Schicksal mit demjenigen so vieler armer Kriegsopfer vergleichen, dann wird es uns klar, dass wir wahrhaft glücklich sind und keinen Grund haben, zu klagen. Das kam auch mir zum Bewusstsein, als ich vor kurzem einen Evakuierungszug sah. – Es war an einem Apriltag. Wir befanden uns auf der Reise (von Zug) nach Hause, um da kurze Ferien zu geniessen. Im Bahnhof zu Zürich angekommen, gewahrten wir einen aussergewöhnlichen Auflauf nach einem militärisch abgeschlossenen Platze. Von Neugierde angetrieben, schlossen wir uns der Menge an und nun vernahmen wir auch das Geheimnis dieser Versammlung. Es käme ein Zug Evakuierter, hiess es, und die zurechtgemachten, aber noch unbesetzten Tafeln im Bahnhofrestaurant liessen uns vermuten, dass sie auf die fremden Ankömmlinge harrten. So standen wir denn da und warteten der Dinge, die da kommen sollten. Da endlich nahte sich der Augenblick, und also kamen sie daher die armen Scharen, Kinder Frauen, Greise, alles in buntem Durcheinander. Es waren Menschen wie wir, und doch ergriff uns eine heilige Ehrfurcht vor ihnen, so leise Wehmut schlich sich ein in unser Herz beim Anblick der Vorübergehenden. War es ihre Gestalt, ihre Haltung oder ihr Benehmen, was uns ergriff? Ich glaube, der Gedanke „es sind Opfer des Krieges“ war es, der uns so grosse Achtung einflösste vor den Fremdlingen. Langsam, wehmutsvoll, einem Leichenzug ähnlich schritten sie vorüber. Da wankt ein Greis vorbei. Silberlocken umkränzen den kahlen Scheitel. Das Haupt ist zur Erde geneigt. Ein Mädchen führt die welke Hand, wohl diejenige seines Grossvaters. Eine Mutter hat die arme Kleine wohl nicht mehr, und der Vater steht wahrscheinlich unter den Waffen. So hat sie niemand mehr als ihren lieben Grossvater hier, in der fremden Welt. Doch wie lange noch? Sind nicht vielleicht morgens schon die Hände des guten Alten starr und kalt? Oh armes Kind, welch düstere Wolke hat deine Jugendsonne dir verdunkelt? Oh armer Greis, wie herb ist das Schicksal deiner alten Tage? – Jetzt hört man das Wimmern und Schreien kleiner Kinderstimmchen. Es nahen sich einige Mütter, ihre Lieblinge auf den Armen tragend. Ein furchtbar trauriger Anblick! Bleich und abgemagert ziehen die jungen Frauen an uns vorüber. Tiefe Wehmut und Trauer blickt aus den abgegrämten Gesichtern. Jeder Hilferuf ihrer Kleinen schneidet ihnen furchtbar ins Herz. Sie können ihnen nicht helfen, ihren Hunger nicht stillen, nur mit bittern, bittern Tränen können sie ihr Köpfchen benetzen. Das ist etwas Furchtbares. Nur eine Mutter kann den quälenden Schmerz dieser Armen vollständig begreifen.“
Freiermuth berichtet weiter, dass diese Menschen laut deren Aussagen vor dem Krieg im Norden Frankreichs wohnten. Bei Kriegsausbruch seien sie, die wehrlosen Kinder, Frauen und Greise, vom Feind wie eine Viehherde weggetrieben worden von ihren trauten Häusern und Gehöften, von den lieblichen Dörfern und Städten, fort von den grünen Matten und trauten Äckern, von ihrer trauten Heimat, in das Land ihrer Feinde. Das sei ein Weinen und Wehklagen, ein Händeringen und Jammergeschrei gewesen, wenn sie gar oft in der Ferne die Rauchwolken ihrer abgebrannten Güter sahen. Da sei’s zum Herzzerreissen gewesen. In der Ferne hätten sie vom Morgen bis zum Abend arbeiten und sich abmühen müssen, für den Feind, der es ihnen so schrecklich gemacht habe.
Weiter schreibt Freiermuth: „Und nun werden sie wieder zurückbefördert nach Frankreich. Doch auch da haben sie nichts Gutes zu erwarten. Ja – ginge es in die Heimat, dann wären sie glücklich; aber solch eine Freude ist ihnen nicht beschieden. Wohl kommen sie nach Frankreich, aber auf fremde Erde, wo sie nichts Besseres zu erwarten haben als in Deutschland. Ihre Heimat ist überflutet vom Feind und wenn der Krieg zu Frankreichs Ungunsten ausfällt, so können sie vielleicht nie wieder die heimatliche Scholle betreten. Das ist das traurige Geschick dieser armen Menschen. Doch noch nicht genug an dem. Nicht nur die Heimat haben sie verloren, nein, auch all ihr Hab und Gut hat ihnen der Krieg geraubt. Nichts, gar nichts besitzen sie mehr als höchstens noch ihre Kleider. Wie viele gibt es, die ihr Leben lang nichts als gespart und gearbeitet haben, um doch wenigstens im Alter etwas besser leben zu können. Und nun? (….) Ein einziger Sonnenstrahl in der Trübnis ihrer Tage ist die kurze Durchfahrt durch die Schweiz. Da finden sie auch wieder Menschen, die sich ihrer annehmen, die sie gastfreundlich bewirten und beschenken und die auch wieder einmal ein mitleidiges Wort mit ihnen sprechen. Das werden sie unserem Vaterlande nie vergessen. Und als sie neu gestärkt vom Bahnhofrestaurant wieder in ihre Wagen zurückkehrten, da trugen alle zum Andenken das weisse Kreuz im roten Feld auf der Brust und mit voller Begeisterung hörte man sie unter Tränen der Rührung ausrufen: „Vive la Suisse, vive la Suisse!“
Fazit von Johann Freiermuth: „Und nun denken wir nach über unser Geschick. Wie gütig ist doch Gott mit uns gewesen! Er hat uns liebreich bewahrt vor all dem schweren Unglück. Wir wollen daher nicht klagen, sondern zufrieden sein mit unserem Los! Ja von ganzem Herzen wollen wir dem Lenker der Schlachten danken und ihn bitten, uns auch fernerhin zu beschützen vor dem schweren Unglück, dem Krieg!“
Ferienzeit
Wir schreiben das Jahr 1916. Johann Freiermuth freut sich auf die zehnwöchigen Sommerferien und schmiedet Pläne, wie er diese Erholungszeit verbringen soll. In einem Aufsatz schreibt er darüber wie folgt:
„Die Haupttaten meiner ganzen Ferienzeit werden voraussichtlich in landwirtschaftlichen Arbeiten bestehen. Aber dennoch glaube ich, dass sich diese Tage ebenso angenehm gestalten werden, wie bei jenen, die nicht wissen, wie sie die Stunden totschlagen sollen. Sobald ich heimkomme (nach Zeiningen), wartet meiner gleich eine herrliche Arbeit, das Kirschenpflücken. Da würde wohl mancher gerne mit mir halten, denn es ist gar schön, im schattigen Laub der Bäume die süssen Früchte zu geniessen und sich auch einmal so richtig satt zu essen an der köstlichen Frucht. Wohl dauert das nicht immer so an; es kommen die Tage der Getreideernte. Da wird mir wohl mancher saurer Schweisstropfen von der Stirne rinnen. Doch das hat nichts zu sagen; es ist ja auch gut, wenn sich der Körper einmal anstrengen muss. Dafür kann man des Nachts besser schlafen. Auch dauert die Zeit nicht so lange an. Es folgen wieder angenehmere Tage, und da gibt es dann auch etwa Zeit, für einige Tage eine Ferienreise zu machen. Bereits habe ich dieser Reise das Ziel gesetzt; denn manchmal schon hegte ich den Wunsch, die westliche Grenze unseres Vaterlandes, wo bekannte Soldaten Wache stehen, einmal zu besichtigen. Nun habe ich also den Plan gefasst, mit meinem Freunde dorthin zu wandern. So wird die Zeit vorbeigehen, und wenn dann die Tage der Kartoffelernte, die fröhlichen Tage des Obstpflückens und des „Weidfahrens“ vorübergezogen sind, dann kann ich wieder mit frischem Geist und freiem Mut nach Zug in die stillen Musenhallen des Konvikts ziehen!“