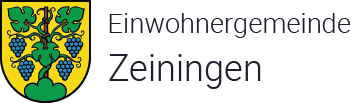Sagen und Legenden
Bergriffserklärung Sagen – Legenden
Sagen sind ursprünglich mündlich überlieferte, kurze Erzählungen, die zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich festgehalten wurden. Eine Sage ist einem Märchen ziemlich ähnlich, denn auch sie enthält übernatürliche Elemente. Anders als Märchen knüpft sie aber an wirkliche Gegebenheiten an, die schliesslich fantasievoll ausgestaltet wurden.
Auch Legenden beruhen auf wirklichen geschichtlichen Ereignissen. Es handelt sich dabei meist um kurze religiöse Erzählungen über Leben und Tod bzw. das Martyrium von Heiligen. Mit dem Begriff „Legende“ können auch Personen oder Dinge gemeint sein, die so bekannt wurden, dass sich um sie Legenden gebildet haben.
Sagen
Bim Säiler Sacher
Dr Sailer Sacher het zmitz im Dorf gwohnt. Vor sim Huus isch e lange Bank gstande. Dr Säiler Sacher isch dee Maa gsi, wo für d Zäiniger Dorfbevölkerig Säili dräiht het: starki Zuugsäili, Halftere und no allerhand füüregi. Näbebi het er au Dubak verchauft. D Männer, wo häi welle rauke, si zoobe zu im go Dubak chaufe. So het s sich ergeh, dass sich d Männer jeden Obe bim Säiler Sacher troffe häi. Dört si die Nöischte verzellt worde. Wenn s schön gsi isch, si si vorussen ufem Bank ghocket und wenn s gräägnet het, si si äifach i d Stuben inä und häi die eso vernääblet, ass si enand fascht nümm gseh häi.
<
Hinderem Holzschopf
Nach em offizielle Märt z Rhyfälde häi d Märtfraue ame ihri Privatchunde bsuecht und nachär häi si sich im Wartegg bim Obertorturm wider troffe. E wohlverdients Znüni het se gstärkt für die witere Strapaze, nämli dr Häiwääg. Dr Drei-Königstich druuf häi si ihri Scheesli miese schüürke, das het se Chraft koscht. Ihri Härz häi zümftig miese schaffe und das het au ihri Nieren aagreggt und si häi gli wider miesen anen Oertli go. Aber wohi? S wär zlang gange bis die nächschti Wirtschaft cho wär. So häi si das Gschäft äifach bi dr letschtmögliche Gläägehäit erleedigt, nämli hindere m Holzschopf ussen a Rhyfälde. Käi Wunder – si dört drum umme d Pflanze so guet gwachse!
Märtfrauegschichte
En elters Märtfraueli isch gmietlich mit sim Scheesli uf dr Strooss gloffe. Es het it gmerkt, ass öppis loos isch. Do het s plötzlich e Truubel um ins umme geh und d „Tour de Suisse“ mit ihrem ganze Drum und Draa isch aagrollt. Aber die het ins it us dr Fassig brocht, es het sich äifach überhole loo.
En ander Mol het es sich ufem Häiwääg uf ene Bänkli gsetzt. Es het e chli wellen uusrueje. Bi dere Gläägehäit het es sini Ynahme zellt und isch derbi ygschlooffe. Wo s verwachet isch, si sini Batze niene meh umme gsi.
Schnapsgschichte
Wenn normalerwys mit de Scheesli, wo s Gmies uf Rhyfälde brocht häi, dr Begriff vu üsserscht reedlicher Aarbet verbunde gsi isch, isch s i den Auge vu de stränge Gsetzgäber it gstattet gsi, ufem glyche Wääg au „flüssigs Gmies“ ufe Märt zbringe. Do het zum Byspill e Bahnarbeiter zueme Märtfraueli gsäit, wo es sis Scheesli über ne schmale Brätterstääg het miese balangsiere: „I mues ech dänk hälfe, it ass dr Kippi machet und denn alles unden uuse tropfet.“
En anderi Märtfrau he au emol e Fläsche Schnaps im Scheesli versteckt gha. Wo sich do d Chundinne sälber bedient und im Scheesli nach em schöönschte Gmies gsuecht häi, isch uf äimol die Fläsche zum Vorschy cho und grad i dem Augeblick het dr Polizischt miesse derzue laufe. Notgedrunge het er miesen en Aazäig erstatte. Het er ächt nie profitiert binere sone „Tour“?
Nöijohhrs-Gratulation
Dr Fridolin Wunderli het bi sine zwo Schwöschtere gwohnt. D Zäiniger häi im dr Dorfname „Scheedel“ geh. Er het käi Bruef gha, isch aber uf ganz verschidene Wääg zu Gäld cho. Er het de Lüt d Hoor gschnitte und am Sundig het er währed dr Mäss dr Orgele Luft verschafft. S Bsundere am Scheedel isch sis äimolig Gedächtnis gsi. Er het d Geburtsdääg vu fascht allne Zäiniger kännt und het an alli Namensdääg dänkt und isch denn au go gratuliere. Au am Nöijohr isch er vu Huus zu Huus und het de Lüt vill Glück gwöischt, Für die Gratulatione het immer öppis uusegluegt für in, am liebschte he er natürlich e Schnaps oder en Almoosen entgege gno.
Karess
„Uf Karess goh“ oder „karisiere“ si Uusdrück, wo me hüt chum me ghört. Vill wüsse villicht gar it, was die bedüte. Käi Angscht, s isch nüt Schlimms! Si häissen öppe so vill wie „zum Schatz goh“ und „schätzele“. Doch zu der Zyt, wo me no uf Karess gangen isch, het e mängen uf Aeiniges miese gfasst si, bsunders wenn äine si Schätzli imenen andere Dorf gha het. Mäischtens häi si no miese z Fuess goh, will me dörzmol no käini Velo gha het. Wenn denn de Liebhaaber nach e paar glückliche Stund bi siner Liebschte dr Häiwääg aaträte het, häin en villicht e paar jungi Burschte in Empfang gnoh, wo it häi chönne verputze, ass er ihnen e Mäitli us ihrem Dorf ewägschnappet. Die häin en denn chönne plooge und it sälten isch es vorchoo, ass sone Burscht het miese dure Bach häilauffe statt u dr Strooss.
Dr Fritz Böni
Vor mehr als 250 Johr het z Mehli e ryche Buur gläbt, dr Fritz Böni. Er isch witumenand dr haabgyrigscht, härzlosischt und wieschtischt Mänsch gsi. Grad domols het s im Fricktal e schweri Zyt geh, e paar Hungersjohr hinderenand. Alli Aern uf em Fäld isch missroote, ummen im Fritz Böni sini isch in voller Pracht dogstande. Er het sini Schüüre chönne fülle. Wo die hungrige Lüt bi im öppis hai welle chaufe, het er ne Wuecherpryse verlangt, zum Byspill e Viertel Land für ne Laib Brot. Uf die Art isch er zuemene Huffe Land und Gäld cho. Mit dem Gäld het er z Mehli 7 stattlichi Hüüser boue, me kännt se a de gstafflete Giebel. Im schöönschte z Ryburg unde het er sälber gwohnt. Aemol zoobe isch en unbekannte Maa inere Jeegerchläidig i das Huus ine gange. Wenn er wider uusenisch het niemer gseh. Am andere Morge het d Magd dr Fritz Böni tod uufgfunde. Mit emen umdräithe Hals und eren uusegstreckte Zunge isch er hinderem Oofe glääge. Nach drei Daag het men en umme mit Mieh uf e Gottsacher brocht und wo d Lüt vu dr Beärdigung häigange si, het er mit siner rote Chappen ufem Chopf vu sim Huus uus uf d Lüt aabegrinst. Sithär het s gschpängschteret i dem Huus, bis men usem Chlooschter z Rhyfälden e Kapuziner gholt het. De het de Gäischt ine Fläschen ine bannt und die Fläschen isch am Süd-Oscht-Hang vom Zeiniger-Bärg bim Bönifelse (Bönistein) vergraabe worde. Me het dem Gäischt miesen erlaube, ass er sich all hundert Johr siner Häimet umene Güggelschritt darf nööchere. Und wenn er denn ämol bi sim Huus z Ryburg unden aachunnt, denn wärden alli Hüüser, wo ämol i sim Bsitz gsi si, zäämegheje.
Miliz
Während em erschte Wältchrieg isch Zäinige ganz bsunders gschützt gsi. S het bi öis e militeerischi Einhäit existiert, wo i keiner Art und Wys vum EMD z Bärn abhängig gsi isch. Die Miliz vu öppe 50 bis 60 Maa isch mit grossem Yfer organisiert worde. I dr Wärchstatt vum Chiefer si sämtlichi Waffe äigehändig us Holz aagfertiget worde, umme d Löif vu de Kanone si us Güllerohr gmacht worde. Di militärisch Rangornig het de verschiedene Schuelstufe entsproche. D Oberstufe het d Offizier gstellt, d Schieler vu dr Mittelstufe si d Soldate gsi und d Erscht- und Zwöitklässler häi dörfe d Läischtig vumene Ross eerbringe. Sogar d Fäldchuchi het ywandfrei funtioniert. D Versoorgig vu dere Truppe isch scho dörzmol e Gäldfroog gsi, doch bimene Metzger häi si grazis eso vill Chnochen übercho, wie si bruucht häi. S het nämli nach jedem Manöver e Suppe geh us uusgchochte Chnoche. S Fläisch, wo nu a de Chnoche gsi isch, isch im Maage vum Chuchischeff glandet, d Offizier häi d Chnoche übercho und d Soldate häi sich a dr uusgezeichnete Suppe gietlich do. Häi d Ross ächt sälber öppis miese go sueche?
Wohär chunnt dr Name „Ängelstäg“
Bis 2019 het dr Fuesswääg vo dr Räbgass id Mühligass über e alte Ängelstäg gfüert. Wäge siner versteckte Laag und dr küene Bogeform isch es woorschinli dr romantischsti Bachübergang vo eusem Dorf gsi. Während langer Zyt he er uf dr Nordsyte kei Gländer gha, au het jeglichi Belüchtig gfehlt. – Wenn dr Hafner Fiddy, wo i dr Mühligass gwohnt het, (und vermuetli au anderi) z nacht nach em „Schlummertrunk“ im „Schuemacher“ oder im „Hirsche“ über de Stäg heigschwankt si, hets e guete Schutzängel bruucht, dass si de Übergang ohne Sturz i Bach hei chönne hinder sich bringe. Und vo dem Schutzängel söll denn dr Name „Ängelstäg“ entstande si.
Weitere Sagen vom Dorf aus dem Buch „Sagen aus dem Fricktal“
Wie der Flurname „Hell“ entstand
Am Südabhang des Herrschaftsberges* befand sich vor vielen Jahren eine grosse Höhle. Einmal an einem düstern Tag, sah man daraus eine schwarze Rauchwolke aufsteigen, und bald darauf loderten mächtige Flammen gen Himmel, wie wenn der ganze Wald in Brand stünde. Erschreckt eilten die Leute herbei, um zu löschen, blieben aber plötzlich wie angewurzelt stehen. Unter dem Höhleneingang stand eine schwarze, fürchterliche Gestalt, eine mächtige Gabel schwingend. Aus Mund und Augen sprühten ihr das Feuer, und Funken stoben aus den zottigen Haaren. Als die Leute die Erscheinung betrachteten, fuhr vom Berg her ein tosender Erdrutsch herunter und deckte Mann und Feuer zu. Die Zuschauer bekreuzten sich und schlichen eilig davon. Das sei der Teufel selber gewesen, erzählte man nachher im Dorfe, denn dort sei das Tor zur Hölle. Seither nennt man die Flur dort allgemein „d Hell*.
*Herrschaftsberg nennen viele Zeininger - vor allem ältere Leute – den Zeiningerberg östlich des Dorfes. Früher war der Wald auf der Hochfläche Säckinger Klosterbesitz, deshalb die Bezeichnung Herrschaftsberg. Heute ist das Gebiet Staatswald.
*D’Hell heisst das Gebiet am untersten Südabhang des Zeinigerbergs östlich der Terrassensiedlung, also im Gebiet des Wäldchens und südlich davon.
Der Geist im Eichenhölzli
Als in den neunziger Jahren des 18. Jh. die Franzosen das Fricktal besetzt hielten und dieselben von den Kaiserlichen bald darauf vertrieben wurden, blieb im Dorfe Zeiningen ein Franzose krank im Quartier zurück. Obgleich er in Feindesland war, wurde er dennoch von den Dorfbewohnern menschenfreundlich gepflegt. Da man sein Ende nahe glaubte, wurde der Ortspfarrer gerufen, um ihn mit den Tröstungen der Religion zu versehen. Der Pfarrer wollte auch sogleich bereitwillig dem Rufe folgen, was aber der Kranke lästernd von sich wies und alles, was die hl. Religion und deren Diener betraf, so beschimpfte, dass die Umstehenden sich entsetzten. Dabei rief er oft einen Namen aus, der ganz heidnisch wie „Waltörn“* klang. Die Bemühungen des guten Pfarrers blieben erfolglos, der Kranke war so verstockten Herzens wie zuvor. Am folgenden Morgen starb derselbe und soll sehr ekelhaft ausgesehen haben, wie der Leichenbeschauer versicherte. Einige billig denkende wollten ihm noch ein Plätzchen in einer Ecke des Friedhofes gönnen, aber die andern widersetzten sich, indem sie glaubten, es könne etwa ihrer Seligkeit zum Schaden gereichen, neben einem Heiden begraben zu liegen. So wurde die Leiche auf einem Karren nach dem Eichenhölzli, einem Vorsprung des Sonnenberges, gebracht. Der Ort war früher als Wasenplatz* benutzt worden. Der Tote aber fand keine Ruhe im Grabe. Man sah ihn oft umherwandeln, besonders wenn Kriege oder Krankheiten um Anzug waren. Seitdem aber dort die Eichen und das Gebüsch weggeräumt worden sind, ist er nie mehr gesehen worden.
Besetzung des Fricktals durch die Franzosen: 17. Juli 1796, der Rückzug begann am 9. Oktober unter dem Drucke einer österreichischen Armee.
*Waltörn, bei seiner heftigen und lästernden Ablehnung alles Religösen berief sich der sterbende Franzose vermutlich auf den atheistischen Schriftsteller Voltaire, was die Bauern als „Waltörn“ verstanden. In ähnlicher Weise wurde das französische „Vive l’empereur!“ in „Pfifelampenöl“ übertragen.
*Wasenplatz, Ort zu Entsorgung von Tierkadavern
Der Schimmelreiter
Vor Zeiten lebte in Zeiningen ein reicher, äusserst geiziger Mann. Täglich ritt er auf seinem Schimmel über sine Güter. Er lieh zu Zeiten der Not den bedrängten Bauern Geld zu Wucherzinsen aus, und wehe ihnen, wenn sie nicht just auf den Tag zahlen konnten. Mit unbarmherziger Härte jagte er sie von Haus und Hof und nahm die Güter selber in Besitz. Fast der ganze Grundbesitz von Zeiningen war ihm so in die Klauen geraten. Als er sein Ende herannahen fühlte, packte ihn die Reue über sein ruchloses Leben. Es war zu spät. Er starb, und der Fluch der armen Leute folgte ihm übers Grab hinaus. Er wurde nicht wie ehrliche Leute auf dem Friedhof beerdigt, sondern man verscharrte ihn droben auf der Eggmatt*, da, wo früher die vier Eichen standen. Seither reitet er jede Nacht auf einem Schimmel in der Geisterstunde rings um den Berg. Wenn die Glocke von Zeiningen ein Uhr schlägt, verschwindet er wieder.
*Egg oder Eggmatt nennt man das Gebiet bei Punkt 508 auf der Grenze Zeiningen/Maisprach. Die Sage erinnert in einigen Zügen an die Fritz Böni-Sage.
Warum das Dorf seinen Standort wechselte
Vor Zeiten lag Zeiningen da, wo sich heute der Naturweiher befindet, in der sogenannten Bättelchuchi*. Einmal herrschte im Dorf die Pest. Ganze Familien fielen der schrecklichen Seuche zum Opfer. Überall in den Häusern und auf den Strassen lagen die schwarzen Leichen herum. Niemand war da, um sie zu beerdigen. Nur drei Personen blieben schliesslich von der Krankheit verschont, und diese zogen weg von der Stätte des Grauens und liessen sich dort nieder, wo heute das Dorf steht
*Bättelchuchi (oder Bättlerchuchi), der Flurname ist heute noch gebräuchlich.
Bättelchuchi (Bättlerchuchi)
In alten Zeiten kam einmal fremdes Volk* in die Gegend. Dieses siedelte sich in der Nähe des heutigen Naturweihers beim Dorf an. Von den Dorfbewohnern verlangten sie unter Drohungen Butter, Mehl und andere Lebensmittel. Dann buken sie und brieten, dass einem im Dorf drin der feine Duft in die Nase stieg. Wenn die Fremdlinge gesättigt waren, bogen sie die Äste der Haselbüsche nieder, tauchten die Blätter in den Teig und liessen diese wieder los, dann hing der ganze Strauch voll goldglänzender Küchlein. Als sie wieder fortzogen, kamen die Kinder und schnabulierten daran nach Herzenslust.
Andere Leute erzählen zwar, dies seien Bettler gewesen, die hätten mit den geschenkten Esswaren so sträflichen Übermut getrieben. Deshalb nannte man später den Ort Bättelchuchi.
*fremdes Volk, fahrendes Volk, Zigeuner, Heimatlose, Bettler usw.
Nächtlicher Fuhrmann auf der Möhliner Höhe
Auf der Möhliner Höhe, da wo das Strässchen nach Zeiningen abzweigt, ist es zu gewissen Zeiten nicht geheuer. Bald versperrt ein kohlschwarzer Hund den Weg, oder eine dunkle Gestalt, deren Umisse man nur undeutlich erkennt, erschreckt den nächtlichen Wanderer. Dann hört man wieder lästerliches Fluchen und Pferdegetrappel, obschon weit und breit kein Fuhrwerk zu sehen ist.
Das ist der ruhelose Geist eines Fuhrmannes, der für seine Untaten hier zu büssen hat. Vor Zeiten, als es weder Bahn noch Auto gab, fuhr ein Fuhrmann täglich mit Getreide über die Höhe nach Basel. Gewöhnlich hatte er für seine zwei Pferde zu viel geladen, und statt sich Vorspann zu nehmen, vertrank er lieber das Geld in einer Wirtschaft. So mochten seine zwei mageren Pferde die Last kaum auf der Ebene. Geschweige denn bergauf zu ziehen. Da half denn unser Fuhrmann mit der Peitsche und seinem Fluchmaul wacker nach, bis einmal seine Pferde unter seinen Schlägen verendeten. Der Mann starb auch bald darauf und muss seither Busse tun für seine Untaten.
Vor Jahren war einmal in Möhlin eine Hochzeit. Am Nachmittag hatte man mit einem Wagen einen Ausflug rheinaufwärts gemacht und kehrte in später Nachtstunde über die Möhliner Höhe heim. Oben auf der Anhöhe bäumte sich das Pferd auf einmal kerzengerade auf und war nicht mehr vorwärts zu bringen. Vor ihm war eine nebelhafte Gestalt aufgetaucht und wieder verschwunden. Vergebens stieg der Bräutigam ab und fasste das Pferd am Zaum. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als über Zeiningen den Heimweg zu suchen.
Hilfe gegen Schadenzauber
Über einen Versegner in Zeiningen berichtet der Pfarrer von Arisdorf (1602): „Etlich suchen bei demselben nit allein verlorener Sachen halber Rath, sondern auch, wenn sie nach gehaltener Hochzeit … bei ihnen selbe, wie sie es dofür halten, impotentiam befunden, wie verschiedene getan, die ihre ausgezauberte Mannheit ihres Erachtens in Zeiningen wieder geholt.“
Die Rinderpest in Zeiningen
Vor über zweihundert Jahren herrschte in Zeiningen unter dem Vieh eine schreckliche Seuche, die Pest; darunter litten die Bauern grossen Schaden, denn alle befallenen Tiere mussten abgetan werden. Ausserhalb des Dorfes wurden in der Eile Holzställe errichtet, wo man die noch gesunden Rinder unterbrachte. Dort blieben einige Männer zu ihrer Wartung. In der Kirche aber beteten die Leute inständig zum heiligen Antonius*, und die Krankheit hörte auf. Sein Fest wird seither besonders gefeiert.
Das an der Seuche verendete Vieh wurde in eine besondere Grube geworfen und man nennt den Ort heute noch Chüeloch*.
*der heilige Antonius (um 251-356), Vater des Mönchtums, wurde als Patron der Tiere verehrt und bei Viehseuchen um Hilfe angerufen.
*das Chüeloch befindet sich auf dem Schönenberg.
Legenden
Zeino - ein christliches Zeichen – eine Kirche
Auf einen interessanten Artikel hinsichtlich der Entstehung von Zeiningen ist Zeguhe* in der Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte Band 84/1990 gestossen. Der Autor Alfred Heubach berichtet darin über eine Begebenheit, die sich im 4. oder 5. Jahrhundert ereignet haben muss:
«(….) Zweifel, dass ein Engel stärker sein könnte als Wodan, der Kriegsgott. Aber der Heilige (Erzengel Michael) erscheint der Frau ein drittes Mal und reicht ihr die Hand. Sie spürt darauf eine Besserung. – Noch sind Zweifel da, vor allem von Seiten Zeinos. Im Dorf sind die Meinungen geteilt – hier Heiden, dort Aju (ein Sklave, den Zeino gekauft hat und der Christ ist) und Zeinos Frau, der es langsam besser geht. Als ein anderer Kranker, der Aju Glauben und Vertrauen schenkt, gesünder wird, ist das Interesse für den heiligen Michael erwacht. Einige wollen mehr wissen über ihn und den Gott, der ihn zu den Kranken sendet, ihnen die Hand gibt. (….) Urs und Viktor, zwei Hauptleute der in Agaunum erschlagenen Thebäer, gelangten mit sechsunddreissig Mann in die Stadt Salodurum (Solothurn). Sie waren alle dem Tode entronnen und geflüchtet. Zu Salodurum herrschte der römische Landpfleger Hirtakus. Dem war vom Kaiser Weisung zugekommen von Agaunum; er liess daher Ursus und Viktor mit ihren Gesellen anhalten und zur Rede stellen. Sofern sie den Göttern opferten, sollte ihnen die Flucht vergessen sein. Ursus antwortete für alle: „Wir sind Christen und kennen nur einen Gott“. Der Landpfleger liess sie darauf in Ketten legen, mit Ruten schlagen und ins Gefängnis werfen. (….) Als Hirtakus vernahm, dass die Christen im Gefängnis gar heiteren Gemütes sich befanden, beschloss er, sie allesamt zu vernichten. Wieder befahl er den Thebäern, den Göttern Jupiter und Merkur zu opfern, wenn nicht, sollten sie den Tod erleiden. Es sprachen aber Urs und Viktor: „Wir fürchten keinen Tod, uns ist Christus vorangegangen“ Hirtakus rief: „Das sollt ihr mir beweisen!“ Alsogleich befahl er, einen mächtigen Haufen Holz zu schichten, die Thebäer zu binden und ohne Erbarmen ins Feuer zu werfen. Aber ein Gewölke stieg am Himmel auf, und ein Blitzstrahl fuhr hernieder. Der zerschmetterte den Haufen und löschte das Feuer. – Hirtakus, darüber noch grimmiger, sprang auf seinen Richterstuhl und fällte den Spruch: „Man soll das Schwert an ihr Haupt legen. „Solche Worte hatten die frommen Gesellen schon vor Agaunum vernommen, erschraken deshalb nicht im Geringsten, sondern liessen sich tapfer wegführen nach der Aarebrücke, knieten freudig nieder, beugten den Nacken und empfingen den Todesstreich (nach Fischer).
Aju erzählte mehr von Christus und dessen Heilungen durch die Macht des Christengottes. Zeino ist eher zurückhaltend. Die Frau aber wird zur Glaubensbotin – eigentlich ist der Bote Aju, aber dessen Einfluss ist kleiner als der der Frau. Eines Tages befiehlt sie dem Sklaven, das Wodanbildnis bei der Quelle zu verbrennen. Grosser Aufruhr im Dorf, grosser Aufruhr vor Zeinos Haus. Der Freie weist die Leute ab: „Aju hat das Bildnis Wodans auf meinen und meiner Frau Befehl verbrannt. Wodan soll sich also an uns rächen. Von heute an gehören unsere heilkräftigen Wasser dem heiligen Michael. Den Namen Wodan müsst ihr vergessen. Ihr habt die Geschichte von Urs und Viktor gehört. Diese Krieger trugen kein Bildnis ihres Gottes herum, und doch schickte ihnen ihr Gott himmlisches Licht in das finstere Gefängnis heilte ihre Wunden, löste ihnen die Ketten, gab ihnen Mut und Kraft, den Tod zu erleiden., Von Odin haben wir nie so etwas gehört. Leute, geht jetzt heim und lasst mir Aju in Ruhe!“ Nur unwillig kehrt die eine Hälfte der Leute in ihre Blockhütten zurück; Aber von der anderen Hälfte sagen einige: „Was unser Herr über die Krieger, die einen so mächtigen Gott hatten, erzählt hat, muss wahr sein. Dieser Gott ist ihnen wunderbar beigestanden.“ – „Aber ihr Gott hat sie nicht vor dem Tod bewahrt!“ – „Sie fürchteten sich aber nicht vor dem Tod, weil ihr Meister, Christus, ihnen im Tod voran gegangen, auferstanden und lebendig sei. Von heute an glaube ich und die, die in unserem Haus wohnen, an diesen Christus.“- „Odin, Donar sind meine Götter“, sagen andere.- So lebten wohl lange Zeit in Zeinigen (Zeiningen) Heiden und Christen (Christgläubige) durcheinander, bis ihnen ihr Herr ein Bild seines Glaubens, ein christliches Kirchlein aufrichten liess. Nach dem frühen Tode seiner Frau, die zum christlichen Mittelpunkt des Dorfes geworden war, mit dem frei gewordenen Aju, lebte Zeino noch viele Jahre. – „Dieses Leben verdanke ich Christus, dem unsichtbaren Gott, dem heiligen Michael“, sagte er oft zu sich und seinen Nächsten. „Sollte ich nicht dankbar sein?»
*Kommission „Zeiningen gestern und heute“.
Ein Zeininger Märtyrer im Dreissigjährigen Krieg
Aus der Chronik von A. Freiermuth: „Am 27. Juli 1637 gelang es Herzog Bernhard trotz energischer Gegenwehr von Johannes Wehrt bei Rheinau den Rhein zu überschreiten. Allein Lebensmittelmangel zwang ihn zum Rückzug seiner Truppen vom rechten Rheinufer und plündernd zog er am linken Rheinufer abwärts und verbrachte den Winter 1637 im Berner Jura, im Delsbergtal. Im Frühjahr 1638 kehrten die Truppen wieder an den Rhein zurück. In einem erbitterten Kampf bei Nollingen wurden die Generäle Wehrt und Savelli neben anderen hohen Offizieren gefangen genommen und nach Laufenburg gebracht. General von Werth wurde dann an Frankreich ausgeliefert und Herzog Savelli in Laufenburg gefangen gesetzt. Savelli gelang aber bald darauf die Flucht und an diese knüpft sich die eigentliche Tragödie, die sogenannte „Bluttat von Laufenburg“. Nach den Akten ergibt sich folgender anschaulicher Bericht vom gefangenen römischen Duca Savelli oder Savello, der auch einen Bezug zu Zeiningen hat: Man sperrte ihn aufs Rathaus in ein anständiges Gemach und stellte ihm Tag und Nacht einen schwedischen Feldweibel ins Zimmer und eine Wache vor die Türe. Gleichwohl gelang es dem schlauen Welschen zu entweichen. Es gelang ihm nämlich, eine Wäscherin, Wwe Nüsslin, für seine Pläne zu gewinnen und jedes Mal, wenn diese ein Bündel Weisszeug abholte oder brachte, war ein Zettel darin an den Gefangenen oder an verborgene Helfershelfer. Während der Fasnacht - die in Laufenburg von jeher mit grossem Pomp gefeiert wurde - gab der Fürst zu Ehren der schwedischen Offiziere ein grosses Gastmahl. Man zechte bis tief in die Nacht hinein, und allen Gästen setzte der starke Wein ordentlich zu. Als die Geladenen sich zurückzogen, wusste Savelli den Feldweibel zu bereden, das Zimmer für einen Augenblick zu verlassen und den aus dem Hause Gehenden die „Honneurs“ (gehoben für die Gäste begrüssen) zu machen. Kaum war der Schwede draussen, so verriegelte der Fürst von innen die Türe. Es war die zur Flucht verabredete Nacht. Savelli öffnete das Fenster und liess sich an einem Strick, den die Frau Nüsslin ihm am Tage zuvor in einem Kuchen versteckt gebracht hatte, über das Vordach des Rathauses hinunter und landete sanft auf einem sich darunter befindlichen Miststock. Die Nüsslin, die hier seiner wartete, zog ihn sogleich in das nächste Bürgerhaus und führte ihn von hier über eine bereitstehende Leiter zum Rheine hinab. Bald hatten die beiden den Felsen am Rheinufer überschritten und schlichen in höchster Stille dem Siechenhaus zu, das sich unterhalb der Stadt, beim heutigen Kraftwerk, befand. Da warteten schon die Pferde, auf denen Savelli über die gebirgige Waldgegend von Hettenschwil bis gegen Leuggern ritt. Hier fand er ein Schiff zur Überfahrt und kaum war er im Strome, so erschienen auch schon die schwedischen Reiter hinter ihm und schossen ihre Pistolen ab, ohne Schaden; Savelli entkam im Dunkel der Nacht glücklich. Er quittierte später die kaiserlichen Dienste und ging nach Rom. Die Flucht Savellis kam aber dem Städtchen Laufenburg teuer zu stehen. Kaum war Savellis Flucht bekannt, so wurden alle Häuser untersucht und jeder Einwohner, vom Schultheissen bis zum kleinsten Kinde in die Pfarrkirche genötigt. Hier hielt man sie unter Drohung eingesperrt, man werde ihnen die Kirche über dem Kopfe anzünden, wenn sie nicht bald ein offenherziges Geständnis ablegten. Kurz darauf drang ein Kommando Soldaten herein, band den Stadtpfarrer Andreas Wunderlin, gebürtig von Zeiningen, und den Kaplan Ulrich Zeller und führte beide ins nahe gelegene Schulhaus zum Verhör. Man hatte beobachtet, dass die Witwe Nüsslin kurz vor der Flucht noch zur Beichte gegangen war, und gerade über diesen Punkt sollten nun die Geistlichen Auskunft geben. Da die Folterwerkzeuge nicht schnell genug aufgefunden werden konnten, brachte man die beiden Männer in das sogenannte Beinhäuschen und setzte sie dort auf eine gewöhnliche Hechel und inquirierte sie so scharf, dass man ihre Schreie bis in die Kirche herüber vernahm. Sie gestanden jedoch nichts, entweder weil sie nicht konnten, oder weil sie das Beichtgeheimnis nicht brechen wollten. Herzog Bernhard von Weimar verurteilte beide zum Tode, und mit ihnen den schwedischen Feldweibel, der seinen Posten verlassen hatte. Der 3. März 1638, damals ein Tag der Karwoche, war zur Exekution ausersehen. Graf Johann von Nassau und der Berner-Patrizier Erlach, der damals als General bei den Schweden diente, hatten den Spruch des Standgerichts zu vollziehen. Frühmorgens wurden auf dem Marktplatz drei Bännen (ein- oder zweirädriges Transportgerät mit offenem Kasten darauf – heute auch scherzhaft ein altes Auto, Anm. Zeguhe) Sand abgeladen, für jeden der Unglücklichen eine. Der Schwedenfeldweibel kam zuerst ans Schwert. Als man die beiden Priester durch die Reihen der ausgerückten Garnison herbeibrachte, schien der hochbetagte Wunderlin kraftlos zu werden und schwankte. „Es ist nur um eine Handvoll Blut zu tun, dann haben wir den Himmel erstritten“, rief ihm sein junger Kaplan zu. Diese Worte richteten den Stadtpfarrer und Kapiteldekan wieder auf. Standhaft erlitt einer nach dem anderen den Tod. Der von den Schweden vorsorglich aufgeführte Sand konnte nicht hindern, dass Blut auf den Marktplatz spritze und jahrelang sah man die Spuren davon. Erst eine neue Umpflästerung hat sie zum Verschwinden gebracht. Lange aber ist die Erinnerung an die furchtbare Tat im Gedächtnis des Volkes haften geblieben. Die Geschichte erhielt in der Folge eine Illustration dadurch, dass das Kapitel Frickgau ein Gemälde in die Kirche von Laufenburg beschaffen liess, das in Abteilungen bestand und die „Beichtende“, die Pastete mit dem Strick, das Rathaus, die Flucht, die Hechel als Folter usw. darstellte.“
Kurze Lebensgeschichte der unglücklichen Frau Franziska Wunderlin von Zeiningen
(aufgeschrieben von Pfarrer Becker im Jahre 1838)
„Maria Franziska Wunderlin, eheliche Tochter des Benedikt Wunderlin und der Katharina Widmer wurde am 11. Februar 1717 geboren, und vom damaligen Pfarrer, Ferdinand Kramer, dahier getauft. Da ihr Vater, insgeheim der krumme Schneider genannt, Ortsvorsteher und Kirchmeier in Zeiningen, auch zugleich Obervogt der Gemeinden der Landschaft Möhlinbach gewesen ist, so bekümmerte er sich nicht viel um die Erziehung seiner zwei Kinder Leonz und Franziska, sondern überlies dieselbe grösstenteils seiner einfältigen Frau, welche die Unarten ihrer Tochter so wenig ahndete, dass sich ihr Bruder gar nicht mehr mit ihr vertragen konnte. Dies mag allerdings Ursache gewesen sein, dass Leonz Wunderlin das väterliche Haus frühzeitig verliess und als Soldat Kriegsdienste in Frankreich nahm.
Obwohl Franziska durch ihr hochmütiges und zanksüchtiges Benehmen sich eben nicht empfahl, wurde sie dennoch von einem vermöglichen Jünglinge, namens Franz Karl Urben, dessen Eigentum die hiesige Ziegelhütte war, zur Ehe verlangt und mit demselben am 10. Hornung des Jahres 1738 durch den damaligen Pfarrer, Johann Melchior Vögelin, ehelich eingesegnet.
Anfangs lebten die jungen Eheleute zufrieden und erzeugten in der Folgezeit sogar acht Kinder miteinander. Als aber der Mann sich der Trunkenheit zu ergeben anfing, und die Frau ihn deswegen mit Vorwürfen überhäufte, gerieten sie in Zwietracht, welche von Jahr zu Jahr dermassen zunahm, dass sie nicht nur einander mit Schlägen oft schrecklich misshandelten, sondern sogar die gänzliche Trennung von Tisch und Bett dringend verlangten. Sie wurden deswegen vor die geistliche und weltliche Behörde öfter gerufen und zuletzt nach Pruntrut vor den Bischof selbst beschieden, dem es endlich mit vieler Mühe gelang, die entzweiten Herzen wieder zu vereinigen.
Doch diese Vereinigung war von kurzer Dauer, denn kaum wohnte das versöhnte Ehepaar wieder einige Zeit beisammen, so liess sich das böse Weib von ihren ungestümen Leidenschaften so weit verblenden, dass sie am 7. Nov. 1754 ihren Ehegatten im Bette, da er eben im ersten Schlafe war, im 44igsten Jahre seines Alters mit einem zweipfündigen Gewichtsteine grausam totschlug.
Als diese gräuliche Mordtat im Dorfe ruchbar geworden, floh die Mörderin, von Gewissensbissen verfolgt, aus dem Hause, und verbarg sich in dem nahe gelegenen Rebberg. Allein sie wurde bald entdeckt, und ins Gefängnis nach Rheinfelden abgeführt. Hier musste sie nach den damaligen Landesgesetzen von den Stabhaltern oder Vorgesetzten aller Gemeinden des Rheinthales verhört, gerichtet, und verurteilt werden in ihrem 38igsten Lebensjahr.-
Nachdem sich Franziska durch eine reumütige Beicht und Kommunion sich mit Gott ausgesöhnt hatte, wurde sie am Vormittag des 20. Christmonats des nämlichen Jahres in den Vorhof des städtischen Rathauses geführt, wo ihr das Todesurteil abermals öffentlich vorgesen wurde, hierauf der Stab von einem Stabhalter gebrochen und vor ihre Füsse hingeworfen wurde. Obschon die Verbrecherin dieses Urteil mit weinenden Augen anhörte, hoffte sie doch, als Tochter des Obervogtes noch immer Begnadigung zu erlangen.
Als sie daher in Begleitung eines Kapuziners, der als Gewissensrat ihr Trost und Mut in den letzten Augenblicken ihres Lebens zugesprochen, zur Hinrichtung vor das obere Stadttor hinausgeführt wurde, ging sie getrosten Mutes und mit gemessenen Schritten der Richtstätte zu. Auf dem Platze des Hochgerichtes angekommen, schaute sie die versammelte Volksmenge (!!) unerschrocken an, sass herzhaft auf den Stuhl und erwartete zuverlässig, der Scharfrichter werde bloss sein Schwert über ihr Haupt schwingen. Allein die Gattenmörderin fand vor der Gerechtigkeit keine Gnade, denn kaum hatte man das gewöhnliche Gebet für die arme Sünderin zu beten angefangen, so flog ihr Haupt vom Rumpfe.
Nun wurde zum warnenden Beispiele ihr Körper auf das Rad geflochten und ihr Kopf nebenzu auf die Stange aufgesteckt.
Dieser schmälichen Hinrichtung schämten sich die Blutsverwandten, besonders der Vater, weil er das Verderben seiner Tochter durch Vernachlässigung in der Erziehung eigentlich veranlasst hatte. Darum fasste sein kühner Sohn, Leonz Wunderlin, der inzwischen aus dem Kriegsdienste von Frankreich heimgekommen war, den kühnen Gedanken, den Kopf seiner Schwester vom Galgen zu nehmen und dann heimlicherweise zu begraben. Zur Ausführung dieser verwegenen Tat wählte er die Heilige Nacht, um desto weniger von jemandem bemerkt oder verraten zu werden. Demnach begab sich Leonz, während die hiesigen Einwohner zum mitternächtlichen Gottesdienste in der Kirche versammelt waren, mit seinem Freunde, Joseph Schneiderlin, von hier, heimlich auf den Weg, nachdem sie kurz vorher die nötigen Werkzeuge gerüstet und sich durch Wein Herzhaftigkeit eingeflösst hatten. Um Mitternacht bei dem Galgen zu Rheinfelden in der grössten Kälte angelangt, hieben sie mit einem Beil die Stange nieder, hoben den Kopf vom Boden und begruben ihn an einem unbekannten Ort im Walde.
Bei dieser ungewöhnlichen Handlung wurden die Täter von einem solchen Schauer überfallen, dass sie mit blassem Gesicht und klopfendem Herzen nach Hause liefen und dem Vater mit heimlicher Offenherzigkeit gestanden, dass sie um alles in der Welt keine Lust mehr hätten, eine Beerdigung auf solche Art und Weise und um diese Zeit vorzunehmen. Bald aber nachher nahm ihre Angst noch mehr zu, als das kaiserliche Oberamt zu Rheinfelden, welches von dieser Freveltag Kunde erhalten hatte, eine grosse Belohnung demjenigen versprach, der diese Frevler bestimmt anzeigen würde. Weil jedoch die oben genannten Männer vor und nach der Tat so vorsichtig waren, nicht einmal ihren Frauen, vielweniger anderen Leuten das Geheimnis anvertrauten, so blieb die Sache verschwiegen, bis vor wenigen Jahren ein Vetter der hingerichteten Frau die ganze Geschichte anderen Menschen erzählte, nachdem die Täter schon längst in die Ewigkeit hinüber gegangen waren.“
St. Agatha hilft
Am 16. Februar 1739, als der Zeininger Pfarrer Ferdinand Kramer die Morgenmesse las, hörte man plötzlich eine tiefe Stimme: „Feuer! Feuer! Es brennt im Oberdorf!“ Voll Angst und Schrecken liefen alle aus der Kirche, aber von einem Feuer war nichts zu sehen. Als man sich nach dem Fürioschreier umsah, fand man ihn schlafend in einem Kirchenstuhl. Er wurde geweckt und später vor Gericht einvernommen, wo er sein merkwürdiges Verhalten rechtfertigen sollte. Er erzählte: „Zu Beginn des Gottesdienstes wurde ich vom Schlaf übermannt. Da träumte mir: In einem kleinen Haus brach Feuer aus, das sich so schnell ausbreitete, dass Leimgasse und Oberdorf nach einer Viertelstunde in Flammen standen. Gegen vierzig Firste verbrannten, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Vier Personen der gleichen Familie kamen in einem Keller um, die fünfte aber wurde gerettet.“ Mit Staunen hatten die Richter zugehört, konnten aber dem Gehörten keinen Glauben schenken. Der Ruhestörer wurde um ein Pfund Wachs* bestraft.
Der Vorfall war bald vergessen. Ein Jahr verging, und es kam wieder der 16. Februar. Es war ein stürmischer Tag, die Leute fast alle in der Kirche. In einem kleinen Haus brach Feuer aus, das schnell um sich griff. In kurzer Zeit standen Leimgasse und Oberdorf in Flammen. Ein heftiger Ostwind trieb glühende Strohbündel bis in die Nähe von Magden. Die Häuser brannten der Reihe nach ab, wie es der träumende Mann vorausgesagt hatte. Vier Personen fanden in den Flammen den Tod. Es waren das ältere Ehepaar Johann Jeck und Margaretha Wunderlin mit ihrem Sohn Anton Jeck und seiner Frau Maria Urben, die vor kurzem ein Kind geboren hatte. Das Kind wurde wie durch ein Wunder aus den Flammen gerettet und samt der Wiege bis in die Bachteln getragen.
Das Traumwunder wurde der heiligen Agatha, der Kirchenpatronin von Zeiningen, zugeschrieben. Ihr verdankte man es, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete. Jemand hatte im Vertrauen auf sie Agathabrot in die Flammen eines brennenden Hauses geworfen, worauf das Feuer plötzlich erlosch.
*Wachs. Seinerzeit wurden Bussen oft in Sachwerten eingezogen.
*Bachteln, Bachtalen, der untere Teil des Taleinschnittes zwischen Buechholden und Pt. 432.
*Heilige Agatha. Patronin gegen Feuersgefahr. Sie wird häufig mit Zange und Kohlenbecken abgebildet. Am 5. Februar, dem Namenstag der hl. Agatha wird in allen katholischen Kirchen Brot gesegnet, dem man besondere körperliche und seelische Heilwirkung zuschreibt.
Trauriges Schicksal eines hiesigen Kindes
(aufgeschrieben von Pfarrer Becker)
„Notburga, eheliche Tochter der hiesigen Bürgersleute, Paul Urben und Maria Jeck, wurde dahier am 7. Jänner des Jahres 1772 geboren und durch den damaligen Pfarrer, Joseph Franz Hauser, feierlich getauft. Da die Mutter frühzeitig gestorben, und der Vater durch Taglohn sein Brot verdienen musste, war das Kind ohne gehörige Aufsicht – meistens sich selbst überlassen.
Dies mag wohl die Ursache gewesen sein, dass Notburga aus kindischem Leichtsinn sich beifallen liess, in ein Bäumchen des Grasgartens, der nicht ihrem Vater, sondern dem Hauseigentümer zugehörte, mit einem kleinen Messer zu schneiden, und vielleicht dasselbe in etwas zu beschädigen. Als Paul Urben am Abend von seinem Tagwerk heimkam, klagten die Hausleute über die kleine Frevlerin. Auf diese Klage entbrannte der Vater in solchem Zorn, dass er das arme Kind zwischen seine Beine nahm, dasselbe mit einer Rute bis aufs Blut geisselte und alsdann mit Heftigkeit auf den steinigen Boden der Küche hinschleuderte. Durch diese schauderhafte Misshandlung fiel Notburga in Ohnmacht, und nachdem man verschiedene Mittel zu ihrer Wiederherstellung vergebens angewendet hatte, gab sie am folgenden Tage, unter gichtischen Zuckungen ihren Geist auf, im neunten Jahre ihres blühenden Alters. Dies geschah am 15. März 1780.
Kaum war indessen dieser plötzliche Todesfall der Obrigkeit kund geworden, so erhielten zwei Ärzte den Auftrag die Leiche des Kindes zu beschauen und hierauf ihr ärztliches Gutachten einzugeben. Nachdem sie den Leichnam bedachtsam geöffnet und jede Verletzung desselben genau untersucht hatten, stimmten beide darin überein, dass der Vater durch sein unmenschliches Benehmen dem armen Kinde das Genick gebrochen und dadurch seinen Tod befördert habe, was sie auch vor dem kaiserlichen Oberamte zu Rheinfelden eidlich bestätigten.
Demnach wurde Paul Urben auf obrigkeitlichen Befehl ergriffen und in das dortige Gefängnis abgeführt. In dem bald hernach mit ihm angestellten Verhör, konnte er zwar die grausame Tat nicht in Abrede stellen; doch wusste er sich damit zu entschuldigen, dass er diese nicht geflissentlich, sondern in der ersten Hitze des Zornes verübt habe. In Betracht dieser Umstände wurde die Strafe dahin gemildert, dass der Übeltäter nur auf drei Monate ins Zuchthaus nach Breisach verurteilt wurde, wo er diese, und so viele andere Missetaten bitterlich beweinte.“
Sektiererei
Chroniker J. Seiler berichtet in seiner Chronik von 1861: „Um 1816 erschien in unsrer Landesgegend (auch in Zeiningen) eine Weibsperson, ansehnlich und in ihrer Darstellung von hohem Stande, die sich Frau Von Krudener nannte, und sonst hin und wieder als eine Gräfin betitelt wurde, mit einem zahlreichen Gefolge beiderlei Geschlechts, und von unterschiedlichen Ständen. Sie hielt sich anfangs auf dem Horn oder Hörnli unweit von Basel auf, und gewann daselbst mehrere Anhänger und Anhängerinnen, beschenkte ihre Besucher mit Büchern verschiedener Gattung, und auch öfters mit Geld und Kleidungsstücken oder auch mit Lebensmitteln. Sie wagten sich endlich als öffentliche Religionsprediger, eine Art Bussprediger, Verkünder zukünftiger Dinge, und anderer besonderer religiöser Verhandlungen aufzutreten. Sie unternahmen besonders öffentliche Andachtsübungen, besonders in Verehrung der auf den Feldern aufgestellten Kreuze, und andern, unterschiedlichen, auffallenden Zeremonien, sowohl auf öffentlichen Feldern und Gassen, als in ihren Wohnungen. – Endlich wurden sie von unserer Landesobrigkeit aufgefordert, diese Landesgegend zu verlassen. Sie begaben sich dann weiters, und unter den nämlichen Gebeten und Handlungen, bald da bald dort sich aufhielten, aber in keinem Ort von langer Dauer geduldet, so dass durch gegenwärtige Jahre kein Zeitungsblatt erschien, das nicht mit einem Stück von der Frau Von Krudener, ihrem Gefolge, und deren Handlung angefüllt war.“
Die „wundersame Heilung“ einer Zeiningerin?
(Quelle: ETH-e-periodica) Unter dem Titel „Schwindel und kein Ende?!“ schrieb H.Z.G in der Zeitschrift „Freidenker“ im Mai 1911: Anfangs Mai zirkulierte speziell in der katholischen Presse der ganzen Schweiz eine Geschichte aus Zeiningen (Aargau) wegen einer merkwürdigen und wunderbaren Heilung von einer von den Ärzten angegebenen, unheilbaren Hautkrankheit. Es wurde auf diesen Fall hin den Freidenkern und ungläubigen Christen von der katholischen Presse ziemlich stark eines angehängt. Kein vernünftiger Mensch nahm diese Wunderheilung ernst und erlaubten sich freisinnige und sozialdemokratische Tageszeitungen diese Meldung unter Glossen zu bringen. Nun können wir heute nach kaum 14 Tagen nach dieser Wundermeldung die Sache den Katholiken zurückbezahlen nebst Zins. Die wirklich geheilter Anna Tschudi ist wohl ein gottesfürchtiges, katholisches Mädchen, war auch anfangs Mai von Lourdes zurückgekehrt und geheilt, aber eben die Frage wie?? … Anna Tschudi war seit 4 Jahren in ärztlicher Behandlung an verschiedenen Orten, wegen einer künstlich ihr selbst beigebrachten Verbrennung, die eine Haut- und Schleimhautkrankheit zur Folge hatte. Sie konnte ihre Krankheit während dieser Jahre unterhalten (wahrscheinlich durch regelmässiges Brennen mit einem Gegenstand), deshalb erklärten die Ärzte Anna Tschudi für unheilbar. Von Lourdes kam das Mädchen gesund heim, da dort die Brennungen unterblieben (wahrscheinlich auch schon früher), die Wunden heilten sich auf gewöhnlichem Wege. Die Anna Tschudi war bloss eine jedenfalls angestiftete Schwindlerin und hat damit der ganzen Welt einen Beweis erbracht, wie Wunderheilungen in Lourdes aus dem gewöhnlichen Brunnenwasser entstehen. - Es sei unseren Lesern die Erklärung des Dr. Herzog, eines weithin als tüchtig bekannten Arztes wiedergegeben. Die katholische Presse berief sich speziell auf Dr. Herzog und fühlte sich bisher gezwungen, die Heilung ins rechte Licht zu stellen. Die Erklärung ist der katholischen Rheinfelder Zeitung entnommen: „Die vielen privaten Anfragen und öffentlichen Aufforderungen in den Zeitungen von hüben und drüben nötigen mich aus der anfangs von mir beobachteten Zurückhaltung herauszutreten und den „wunderbaren Heilungsfall“ in Zeiningen in einer andern als der bisherigen Beleuchtung erscheinen zu lassen. Da mir die Geschichte schon mehr als genug Ärger und Verdruss, Schreibereien und Gänge verursacht hat und ich noch Wichtigeres zu tun und zu deuten habe, will ich mich möglichst kurz fassen. Nach von mir im Bürgerspital Basel, wo Anna Tschudi zum letzten Mal im Juli 1908 in Behandlung war, eingezogenen Erkundigungen, handelt es sich bei ihr um eine an ihr selbst künstlich durch Verbrennung hervorgerufene und unterhaltene Haut- und Schleimhauterkrankung. Dass in diesem Falle auch die wunderbare Heilung keiner weiteren Erklärung bedarf, wird wohl jedermann einleuchten. Nun leugnet allerdings Anna Tschudi, einen solchen frommen Betrug begangen aus der krankhaften Sucht, bemitleidet und schliesslich bewundert, beneidet und berühmt zu werden, entschieden ab und ich muss deshalb den Ärzten und Angestellten der dermatologischen Abteilung des Basler Bürgerspitales die Verantwortung für ihre dahin lautenden bestimmten Aussagen überlassen. Für mich und wahrscheinlich für jeden naturwissenschaftlich Gebildeten ist damit das Tatsächliche dieses Falles erledigt und bleiben eventuelle weitere Schritte abzuwarten.»
Anmerkung Zeguhe: Weitere Schritte sind offensichtlich nicht erfolgt, zumindest in den Archiven der Kirchgemeinde Zeiningen und der Einwohnergemeinde Zeiningen konnten hierüber keinerlei Unterlagen aufgefunden werden. Die älteste Einwohnerin von Zeiningen mag sich noch erinnern, dass damals im Dorf von einer „wundersamen Heilung“ geredet wurde und die Leute eher davon ausgingen, dass Anna Tschudi keine Betrügerin war. - Tatsache bleibt aber, dass eine Heilung stattgefunden hat, sei es, dass Anna Tschudi von einer unheilbaren Haut- und Schleimhauterkrankung oder zumindest von einer „krankhaften Sucht“ geheilt wurde, denn Frau Tschudi konnte ab diesem Zeitpunkt offenbar ein normales Leben führen und heiratete am 16. Juni 1919 einen Mann aus Siglistorf. - So einfach, wie die „Freidenker-Zeitung“ damals berichtete, dass Anna Tschudi der ganzen Welt einen Beweis erbracht hat, wie Wunderheilungen in Lourdes aus dem gewöhnlichen Brunnenwasser entstehen, ist die Sache nun auch wieder nicht. Seit den Erscheinungen von 1858 in Lourdes, soll es dort rund 30‘000 Heilungen gegeben haben; davon sind 6‘000 dokumentiert, 2‘000 gelten als „medizinisch unerklärlich“. Nur 67 Heilungen wurden aber von der Kirche als „Wunder“ anerkannt. Eine medizinische Beurteilung einer Heilung als „unerklärlich“ bedeutet somit nicht zwangsläufig, dass die kirchlichen Instanzen ein Ereignis als „Wunder“ einstufen.