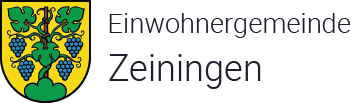Das Habsburger Urbar
Verdient gemacht hat sich besonders die Regierung König Albrechts I. durch die Erstellung des „Habsburger Urbar“. Am 6. April 1307 verlieh König Albrecht, von Rheinfelden aus, durch Brief die Fürstenwürde an die Äbtissin von Säckingen, Elisabeth von Bussnang. Das Habsburger Urbar verschafft uns ein Bild von den rechtlichen Zuständen unserer Heimat um die Wende des 13. Jahrhunderts. Der Zerstörungsprozess, durch den die ursprünglich einheitliche Karolingische Gauverfassung gesprengt wurde, hatte in unserem Gebiet ziemlich früh eingesetzt. Eine Zersplitterung in kleinere Verwaltungsgebiete zeigte sich besonders beim Augstgau, bei welchem zuletzt zwei neue Gaue zum Vorschein kamen, der Sissgau (Baselland und Rheinfelden mit umliegenden Ortschaften) und der Frickgau. Die landgräfliche Gewalt lag beim Kloster Säckingen mit seinen Besitzungen in den Dörfern des Fricktals. Die Machtstellung der Habsburger, wie sie im Urbar zum Ausdruck kommt, floss aus drei verschiedenen Quellen zusammen, aus Eigenamt (Gebiet zwischen Aare und Reuss südlich von Brugg, Anm. Zeguhe), aus Vogteien über Klöster und aus der gräflichen Gewalt. Der älteste habsburgische Besitz öffentlich-rechtlicher Natur im Aargau war die Vogtei der Güter des im Elsass gelegenen Klosters Murbach. Schon 1135 kamen sie in deren Besitz. Als solche übten sie die Gerichtsbarkeit über die Gebiete des Klosters in den Gemeinden Möhlin, Schupfart, Wittnau, Gipf, Rain und Elfingen aus.
Die sogenannten Rechte und Einnahmen nach dem Habsburger Urbar:
Als Habsburger Urbar bezeichnet wird ein nach geogr. Gesichtspunkten geordnetes Verzeichnis der habsburgischen Einkünfte aus Eigengütern, gerichtsherrlichen Rechten, Kirchenpatronaten und Steuerrechten sowie eine Zusammenstellung der Ansprüche auf entfremdete und verpfändete Rechte in den habsburgischen Vorlanden (Vorderösterreich). Nach österr. Vorbild (Rationarium Austriae, ca. 1287) und nach verschiedenen kyburgischen und habsburgischen Rödeln (Verzeichnisse) aus der 2. Hälfte des 13. Jh. wurde 1303-07 auf Betreiben König Albrechts I. die habsburgische Finanzverwaltung in 66 ländl. und städt. Ämtern in Schwaben, im Elsass und im Gebiet der nachmaligen Schweiz im Zuge der Intensivierung der Territorialherrschaft umfassend inventarisiert. Die sehr detaillierte Aufnahme der Konzeptrödel erfolgte aufgrund eidlicher Aussagen der Abgabepflichtigen vor Ort und der Auskünfte der Vögte. Die Angaben wurden in den sog. Ausfertigungsrödeln vereinheitlicht, z.T. evtl. durch den Vorsteher der Finanzverwaltung, Burkhard von Frick. Eine Reinschrift wurde 1330 erstellt. Nach der Eroberung des Aargaus 1415 wurde das Habsburger Urbar ― wie das in Baden verwahrte habsburgische Archiv der Vorlande überhaupt ― in Luzern gelagert und weiter verteilt. Dadurch dürften einzelne Teile verloren gegangen sein, besonders solche zu Innerschweizer Gebieten. Die nicht eidg. Gebiete betreffenden Abschnitte wurden erst nach Abschluss der Ewigen Richtung 1474 (war ein Friedens- und Bündnisvertrag, den die acht Orte der Alten Eidgenossenschaft 1474 mit Herzog Sigismund von Tirol abschlossen, Anm. Zeguhe) an die Herzöge von Österreich ausgeliefert. Das Habsburger Urbar, eines der frühesten landesherrlichen Herrschaftsinstrumente dieser Art im Reich, ist eine wichtige Quelle für verfassungs-, sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen. (Quelle: Chronik AF)