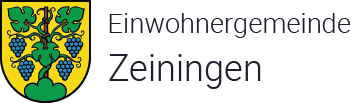Der Fluorkrieg im unteren Fricktal, ab 1950
Ab 1950 wurde in der Aluminiumhütte in Badisch Rheinfelden in steigendem Masse Aluminium produziert. Dabei wurde das Lösungsmittel Kryolith verwendet, das aus einer chemischen Verbindung von Aluminium, Natrium und Fluor besteht. Beim Herstellungsprozess von Aluminium wurde Fluor frei und entwich als Gas oder Staub in die Atmosphäre und setzte sich auf den Pflanzen und am Boden ab. Dadurch waren Fluorvergiftungen sowohl bei Tieren und Pflanzen je nach Fluormenge und der Dauer der Einwirkung zu erwarten. Bei Westwind wurden diese Fluoremissionen auf Schweizer Gebiet getragen und gefährdeten im unteren Fricktal die Gebiete der Gemeinden Rheinfelden, Magden, Möhlin, Wallbach, Mumpf, Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten. Die Geschädigten Landwirte taten sich zusammen, wählten eine Kommission, die sogenannte Fluorkommission, und übertrugen ihr die Wahrung der Interessen. Anderseits hat sich die Aluminium AG in Zürich (Alusuisse) bereit erklärt, stellvertretend in der Schweiz für die deutsche Gesellschaft aufzutreten. So blieb es den Geschädigten in der Schweiz erspart, sich mit ihren Ansprüchen an deutsche Gerichte zu wenden. In der Folge sind von den Parteien in den Jahren 1956 bis 1958 verschiedene Schiedsabkommen abgeschlossen worden, die den Geschädigten ein kosten-/riskoloses und einfaches Rechtsverfahren gewährten und die Ermittlung und Abschatzung der auftretenden Fluorschäden paritätisch bestellten Experten übertrug. Die Abschatzung der Schäden funktionierte einigermassen zufriedenstellend.
Die Werkleitung hat in den folgenden Jahren grosse Anstrengungen unternommen und viele Millionen Mark investiert, um mit Hilfe von Gasreinigungsanlagen, Gaswaschanlagen, Dachsprühanlagen usw. den Ausstoss von Fluor ganz erheblich zu reduzieren. Desto trotz entstanden immer grössere Spannungen zwischen den Parteien, die oft zu unerfreulichen Auseinandersetzungen führten und auch in die Öffentlichkeit getragen wurden. Auf den 31. März 1962 kündigte die Alusiusse die Schiedsabkommen, erklärte sich aber gleichzeitig bereit, neue Vereinbarungen abzuschliessen, die vor allem eine gründliche Abklärung der Tatbestände bei den Viehabschätzungen hätten vorsehen sollen. Die Verhandlungen der Parteien führten zu keinem Ergebnis, ebenso wenig Erfolg hatte die Mitwirkung der aargauischen Regierung. Diese ersuchte dann im Jahre 1963 den Bundesrat um seine guten Dienste zu einer Vermittlung, wozu sich die Landesregierung bereit erklärte. Unter dem Vorsitz von alt Bundesrichter Dr. Danegger kam vorerst eine provisorische Schiedsvereinbarung für Viehschäden zustande, die bis zum Mai 1965 Gültigkeit hatte. Weil eine definitive Schiedsvereinbarung innert nützlicher Frist nicht möglich schien, legte man sich auf einen Pauschalvertrag fest, dessen Gültigkeit bis 30. April 1967 befristet wurde. Dieses Vertragswerk ermöglichte es, in der Zwischenzeit die erforderlichen wissenschaftlichen Abklärungen durch eine vom Bunde zu ernennende, unabhängige Expertenkommission vornehmen zu lassen, deren Ergebnisse in eine allfällige def. Schiedsvereinbarung aufgenommen werden sollten. Der Vertrag sah für die nächsten zwei Jahre einen jährlichen Pauschalbetrag zur Abgeltung von Fluorschäden im Fricktal vor, welcher der Fluorkommission von der Aluminiumhütte Rheinfelden zur Verfügung gestellt wurde. Da alle prominenten europäischen Fachleute auf dem Viehsektor in den letzten Jahren irgendwie im fraglichen Gebiet tätig gewesen waren, beauftragte der Bund drei amerikanische Spezialisten mit der Durchführung der Expertise, wofür er sich unter Übernahme der Kosten verpflichtet hatte. Diese ergab, dass viele Tiere zum Teil massive Schädigungen und Symptome (Fluorose) aufwiesen.
Eine Tabelle zeigt, dass in Zeiningen, das damals einen Rindviehbestand von 487 Tieren aufwiese, in den Jahren 1955 – 1958 62 Tiere (12.7 %) übernommen und entschädigt wurden (Quelle: e-periodica.ch).
(Anm. Zeguhe: Die vorstehenden Angaben, die auszugsweise der schweiz. Fachzeitschrift für Tierheilkunde, Band 101, 1959, entnommen wurden, stellen die Situation u. E. etwas geschönt dar.)
Die Lage aus der Sicht der betroffenen Landwirte ist in einem Artikel von Henri Leuzinger, welcher 2016 in der Aargauer Zeitung publiziert ist, in einem etwas anderen Licht abbildet: «Die Stimmung ist aufgeheizt, in jenen Juni-Tagen 1958. Wutentbrannt blicken viele Bauern über den Rhein, sehen die Rauchschwaden, die vom Aluminiumwerk in Badisch-Rheinfelden tagtäglich aufsteigen, wissen, dass die darin enthaltenen Fluoride den Böden und dem Wald im unteren Fricktal arg zusetzen – und fühlen sich hilflos.» Die Fluoride entstehen bei der Elektrolyse der bis zu 60'000 Tonnen Aluminium, die in Badisch-Rheinfelden pro Jahr produziert wurden. Leuzinger meint: «Die Konzernleitung wollte das Werk nie ernsthaft sanieren. Die Bauern zu entschädigen, kam günstiger.»
Sechs Jahre schleppen sich die Verhandlungen mit der Aluminium Industrie Aktien Ges. (AIAG), der späteren Alusuisse mit Sitz in Zürich, nun schon hin. Es ist ein stetes Auf und Ab. Die Taktik der Firma erweist sich dabei als ebenso berechnend wie wirkungsvoll: abstreiten, solange es geht; die Gutachten anzweifeln, so weit möglich; auf Massnahmen an den Anlagen verweisen, welche im Endeffekt nur wenig bringen; zahlen, wenn es gar nicht mehr anders geht – aber nicht als Eingeständnis einer Schuld, sondern als freiwillige Entschädigung ohne jeglichen Rechtsanspruch. Zu gross war die Angst in der Firmenzentrale in Zürich davor, dass bei einem Nachgeben die Dämme brechen könnten – im Wallis betrieb die AIAG zwei deutlich grössere Aluminiumwerke.
Verbrannte Blätter an den Bäumen
1954 schreibt die Firmenleitung in einem Brief an die Gemeinde Möhlin, dass ihr die gemeldeten Schäden gänzlich neu seien – und dies, obwohl bereits im Jahr zuvor erste Untersuchungen liefen; und dies, obwohl rund um das Aluminiumwerk in Chippis (VS) schon Jahrzehnte zuvor ähnliche Symptome beobachtet wurden: Blätter, die sich rostrot verfärbten und verbrannt aussahen; Kühe, die erkrankten und geschlachtet werden mussten.
Die Gemeindebehörden schlagen Alarm, holen den Regierungsrat an Bord, schreiben dem Bundesrat. Da die Emissionsquelle in Deutschland liegt, ist das Aussenministerium zuständig. Erste Zahlungen erfolgen – widerwillig. Die Gemeinden erhöhen den Druck, erreichen, dass die «Kommission zur Bekämpfung der Fluorschäden in Rheinfelden, Möhlin und Umgebung» ins Leben gerufen wird. Ihr gehören Behördenvertreter ebenso an wie Fachleute und Firmenvertreter. Präsidiert wird sie von Franz Metzger, Gemeindeammann von Möhlin. Bei seinem Rücktritt 1985 sagt er: «David hat langsam den Goliath ein wenig in die Knie gezwungen, aber das Problem ist nicht gelöst.»
Dass nichts mehr ging, lag auch an Bundesbern. Die Behörden sahen in der AIAG lange einen vertrauenswürdigen Verhandlungspartner – «durchaus eine Fehleinschätzung», (….) «David hatte keine Schleuder.»
«Grosstierquälerei im Fricktal»
Derweil schleuderte Carl Stemmler-Morath, ein international renommierter Zoologe aus Basel, im Juni 1958 in einem Beitrag im «Tierfreund» verbale Pfeile gegen die «Grosstierquälerei im Fricktal» und berichtet von Menschen und Tieren, die seit bald sechs Jahren «im Giftregen der Aluminiumwerke von Rheinfelden vegetieren müssen». Der Pfeil sitzt; nationale Medien greifen das Thema auf und berichten über den «Fluor-Terror im Fricktal».
Zur selben Zeit, in jenen warmen Juni-Tagen 1958, erreicht der Protest im Fricktal seinen ersten Höhepunkt. Sämtliche politischen Parteien rufen zur Protestkundgebung nach Möhlin auf. «Wir erwarten den Aufmarsch aller Fricktaler zum Zeichen unseres unbeugsamen Willens, diesem rechtlosen Zustand endlich ein Ende zu setzen», heisst es im Aufruf. «Von 12.00 bis 12.05 Uhr wird in allen Gemeinden des Bezirks Rheinfelden Sturm geläutet.»
Mehr als 5000 Personen folgen dem Aufruf. Bauern besetzen nach der Demonstration mit ihren Traktoren die Rheinbrücke, wollen sogar vor die Tore der Firma ziehen. Sie lassen es auf Rat einiger Teilnehmer bleiben – zum Glück, denn die Belegschaft, die um ihre Arbeitsplätze bangt, hat Wind davon bekommen und steht bereit. «Es wäre zu einer wüsten Schlägerei gekommen», ist sich Leuzinger sicher.
Die Wut der Arbeitnehmer
Erstmals kommt nun – dank der Hartnäckigkeit der Fluorkommission und dank der Intervention von Bundesrat Max Petitpierre – Bewegung in die verworrene Situation. In einer Vereinbarung verpflichtet sich die AIAG, zusätzliche Absorptionsanlagen zu installieren und die Produktion um 30 Prozent zu drosseln. Die Quittung bekommen die Arbeitnehmer: Die AIAG streicht postwendend 370 Stellen, Badisch-Rheinfelden fehlen zudem 50'000 D-Mark Gewerbesteuern pro Monat. «Die Massnahmen dürften wohlkalkuliert gewesen sein», sagt Leuzinger. «Denn der Zorn im Badischen richtet sich nun voll auf die Fricktaler Bauern.» Der Gemeinderat in Badisch-Rheinfelden nennt es unverhohlen eine «Vernichtung der Lebensgrundlage eines wesentlichen Teils der Bevölkerung».
Es geht im gleichen Hick-Hack-Stil weiter. «Die AIAG hatte einen extrem guten Draht nach Bundesbern», weiss Leuzinger von seiner dreimonatigen Recherche. So gelingt es der Konzernleitung, einen geplanten TV-Beitrag über den Fluorkrieg zu stoppen.
Protestmarsch nach Zürich
In diesem verhärteten Klima geht wenig. Aufgebrachte Bauern aus Möhlin + Umgebung fahren deshalb mit ihren kranken Tieren im Dezember 1963 nach Zürich und marschieren mit ihnen durch das Seefeld in Richtung Konzernzentrale der Alusuisse. Diese erreichen sie nicht – die Polizei hat die Zentrale weiträumig abgeriegelt. Durch eine Indiskretion wusste sie vom Protestmarsch.
Proteste, Versprechen, Verhandlungen, (Pauschal-)Zahlungen. Noch bis 1991 zieht sich der Fricktaler Fluorkrieg hin. Mal gehen die Wogen hoch, mal ist es etwas ruhiger, weil die Schäden temporär zurückgehen. Anders als die Werke im Wallis wollte die Konzernleitung das Werk in Rheinfelden «nie ernsthaft sanieren», ist Leuzinger überzeugt. «Man spielte auf Zeit. Die Bauern zu entschädigen, kam günstiger.»
1991 wird die Elektrolyse-Produktion von Aluminium in Badisch-Rheinfelden eingestellt. Weit über 2500 Kühe und Rinder sind seit 1952 an den Folgen der Fluorid-Emissionen verendet.