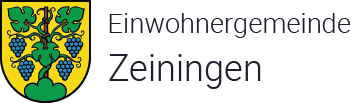Der Zweite Weltkrieg, 1939 - 1945
Die Aufarbeitung der Geschichte unserer historisch verbundenen Landschaft war seit der Gründung der Fricktalisch-Badischen Vereinigung deren Hauptanliegen. Zwischenzeitlich verfügt man nun über Kenntnisse von Vorgängen, die damals nur wenigen bekannt waren. Da Geschichte vor allem von Menschen handelt, soll die heutige Generation auch wissen, wie man damals gedacht und empfunden hat. Aus historischer Sicht und aus persönlicher Erfahrung heraus sollen ein paar Streiflichter auf jene dunkle Zeit geworfen werden, um sie zu erhellen. – Seit jeher verband die Bevölkerung dies- und jenseits des Rheins ein freundnachbarliches Grenzverhältnis, das durch enge kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen geprägt war. (…) So pflegten die Angehörigen beider Staaten stets bewusst den Kontakt untereinander und verfolgten die politischen und wirtschaftlichen Geschicke ihrer Nachbarn. Die Presse bestätigt das: „Liebes badisches Nachbarvolk! Wir, die Fricktaler, sind und bleiben deine guten Nachbarn. (…) Wir bleiben immer eingedenk, dass wir Brüder sind und eines Stammes und jahrhundertelang zusammengehörten. (…) Verwandtschaftlich und kulturell gehören wir zusammen.“
Deutschland litt anfangs der dreissiger Jahre schwer unter der Weltwirtschaftskrise und der daraus resultierenden Arbeitslosigkeit. Über die Rheingrenze hinweg wurden in der Folge zahlreiche Lebensmittelgaben gereicht, um die Not der krisenbetroffenen Nachbarn zu mildern. Man half einander. Schweizer Unternehmer, die schon im vorigen Jahrhundert ennet der Grenze investiert und Fabriken gegründet hatten, spürten den wirtschaftlichen Druck auch auf ihren Betrieben lasten.
In einem ungefähr zehn Kilometer breiten Streifen beidseits des Rheins blühte der sogenannte kleine Grenzverkehr. Zu den Schweizer Geldinstituten kamen viele deutsche Kunden, die wohl in Erinnerung an unsichere, inflationäre Zeiten im eigenen Land, ihre Ersparnisse hier deponierten. Da die Währung am Rhein 1 : 1 gewechselt wurde, gestalteten sich umgekehrt die Preise für viele Schweizer Grenzgänger vorteilhafter. Das gesellschaftliche Leben war der Grenzsituation entsprechend über den Fluss hinweg rege. Das traditionelle Fridolinsfest, anfangs März in Säckingen, war alljährlich Treffpunkt der Hotzenwälder und der Fricktaler. Auch die Wallfahrt nach Todtmoos war Teil der grenzüberschreitenden Aktivitäten. Über diese speziell empfundene Grenzsituation in der Region schreibt der Fricktal-Bote mit Recht: „Die Grenzbevölkerung ist in einer Lage, die man nicht recht versteht landeinwärts.“
In diese Zeit hinein fiel der Aufstieg Adolf Hitlers und seiner Partei. Als dieser 1933 die Macht übernommen hatte, war man sich in der Schweiz nicht schlüssig darüber, wie man ihn und seine Politik beurteilen sollte. Während beispielsweise das Aarg. Tagblatt mutmasste, dass Deutschland nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler „innert kürzester Zeit eine braune Diktatur haben wird“, gab die Neue Aargauer Zeitung ihrerseits zum Ausdruck, „dass der Regierungswechsel auf die Aussenpolitik des Reiches keinen entscheidenden Einfluss haben wird.“
Im Grenzraum spürte man hingegen die konkreten Auswirkungen der neuen Regierung. Die „gute, alte Tradition, besonders an der badischen Grenze, wird meistens etwas getrübt durch das Treiben einiger nationalsozialistischer Jungburschen …“, klagte ein Regionalblatt.
Freilich muss festgehalten werden, dass die NSDAP im Gebiet des Schwarzwaldes einen ausgesprochen schweren Boden vorfand. Sie traf hier nicht auf jene breite Zustimmung oder Unterstützung, ja Begeisterung, wie sie es in anderen Teilen des Reiches gewohnt war. In Säckingen wurde noch anfangs März 1933 das Begehren, eine Hakenkreuzfahne auf dem Rathaus hissen zu dürfen, vom sofort einberufenen Gemeinderat abgelehnt. Erlaubt war lediglich eine solche bis sechs Uhr abends auf dem Rathausplatz. Ein gegen jüdische Geschäfte gerichteter Boykottaufruf, erfasste in Säckingen eine jüdische Firma nicht. Die NS-Ortsgruppe machte mit dem vollen Einverständnis der erdrückenden Mehrheit der Bevölkerung eine Ausnahme. Das politische Gesicht Adolf Hitlers wurde auch allmählich in der hiesigen Lokalpresse erkannt. Schwankte ihr Urteil noch zu Beginn der Machtergreifung und befürwortete sie teilweise sein Vorgehen anlässlich des Reichstagsbrandes, wo es um die Zerschlagung der linksgerichteten Opposition ging, so erweckten der Hass und die Hetze, die blutigen Ausschreitungen und Verfolgungen des Staats zunehmend Argwohn und Besorgnis in der öffentlichen schweizerischen Meinung. Die nächsten Jahre standen ganz im Zeichen der Konsolidierung der NSDAP im Badischen und dem parallel dazu verlaufenden schrittweisen Abbau der Beziehungen zwischen der Grenzbevölkerung. Grund waren einerseits Restriktionen im wirtschaftlichen Bereich (schärfere und einschränkende Devisen- und Zollbestimmungen), andererseits auch das zunehmend unversöhnlich werdende gesellschaftlich-politische Klima. Bereits 1933 wurden zahlreiche deutsche Bürgermeister in der badischen Nachbarschaft von vorgesetzten Stellen ihres Amtes enthoben und durch regimetreue ersetzt. Zwar beschwor die NS-Propaganda die alte „Blutsverwandtschaft“ der Rheinbevölkerung eindringlich und versuchte, den Zusammengehörigkeitscharakter und parallel dazu den Anschlussgedanken für sich auszunützen. Dies gelang ihr aber nicht. Exemplarisch für diese Bemühungen steht der sogenannte „Alemannentag“ in Säckingen. Ziel gemäss der offiziellen Parteipresse war es, „… den alemannischen Stammesgenossen und Freunden jenseits des Rheins Gelegenheit zu geben, das neue Deutschland an seinem wahren Wollen und Streben kennenzulernen.“
Das intensive Werben (deutsche Bürgermeister sollen im Fricktal herumgereist und die Werbetrommel gerührt haben) stiess bei der Bevölkerung aber auf wenig Gehör. Ganz zum Unmut der Parteipresse, die ihre Bewegung als solche durch die Schweiz verunglimpft sah. Das wiederum bewog den Fricktal-Boten, die Wogen zu glätten und das gutnachbarliche Verhältnis hervorzuheben. Das Blatt reagierte auf die Anfeindungen der deutschen Parteiblätter und hängte den Propagandagedanken der Veranstaltung tiefer, indem es, teilweise verharmlosend, beschwichtigte: „Kein Schweizer, (…), bekundet damit, dass er einem Anschlussgedanken huldigt. (...) Auch die politischen Verhältnisse drüben berühren uns sehr wenig, zumal bei genauerem Zusehen die Dinge gar nicht so bös stehen. (…). Hier wieder ordentliche Verhältnisse anzubahnen und freundnachbarliches Einvernehmen zu pflanzen, ist der Besuch des Alemannentages in Säckingen durch unsere Fricktaler Grenzbevölkerung wert. Nach der Devise: Freundschaft erhält – Freundschaft verzehrt – empfehlen wir den Besuch des Alemannentages.“ Die Fricktaler hatten sich ihre Meinung aber gemacht. Der Anlass, an dem am Sonntag ein grosser Vorbeimarsch am badischen Statthalter, Robert Wagner, stattfand, zog rund 4000 Besucher an, davon 800 SA-Leute und 2000 Hitlerjugend-Angehörige. Die Schweizerbeteiligung war hingegen äusserst schwach. Bei den wenigen Schweizer Festbesuchern handelte es sich mehrheitlich um junge Leute aus „den zurückliegenden Dörfern des Baselbietes und des Fricktales, die die Neugier angezogen hatte.“
Mittlerweile errichtete Hitler mit Hilfe seines ihm ergebenen Parteiapparates in Deutschland zunehmend ein Gewalt- und Terrorsystem. Bereits 1934 anlässlich der Liquidation der eigenen ehemaligen Kampfgefährten (im Röhmputsch) kommentierte das Aargauer Tagblatt die blutigen Ereignisse: „Unglücklicher hätte die „Säuberungswelle“ des „Führers“ im „Dritten Reich“, die der ganzen zivilisierten Menschheit Schrecken und unüberwindliche Abscheu vor den Machthabern des braunen Regimes einflösste, aussenpolitisch kaum erfolgen können.“ Den Trennungsprozess im Grenzraum, der sich über mehrere Jahre hindurch erstreckte und verschärfte, kann man mit einer anbrechenden Eiszeit in allen Bereichen vergleichen. Viele Erfahrungen und Erlebnisse der Grenzgänger bestärkten die Einsicht, dass in Deutschland je länger je stärker ein rauer Wind zu wehen begann. Ein Klima der Verunsicherung, ja der Angst, beschlich spürbar die badischen Nachbarn unter dem Eindruck der repressiven und willkürlichen Massnahmen der braunen Gefolgsleute. Neue Zöllner tauchten auf; sie sprachen hochdeutsch und waren sehr streng. Die Schikanen beim Übertritt mehrten sich. Das ehemalig gute Einvernehmen und die reibungslose Zusammenarbeit der deutschen und schweizerischen Zollbehörden wich zusehends. In Schweizer Firmen im Grenzraum setzten sich neuernannte NS-Kontrollpersonen in Szene. Vermehrt war Militär zu sehen und Marschmusik zu hören. Die auffällige Beflaggung der Rheinortschaften, die zackigen Aufmärsche und Fahnenparaden machten auch Eindruck auf manchen Schweizer. Es gab viele Leute, die der Ausstrahlungskraft der protzigen Selbstdarstellung des Dritten Reiches bis zu einem gewissen Grad erlagen. Das wirtschaftlich aufblühende und selbstbewusste Deutschland von 1935 war längst noch nicht das Deutschland von 1945 mit den Bildern der ausgemergelten Leichen in den geöffneten Konzentrationslagern. Viele Deutschschweizer hatten den Ersten Weltkrieg zudem noch in Erinnerung, und mancher sah im Versailler Vertrag ein hartes und vielleicht ungerechtes Joch für Deutschland und eine Ursache der Weltwirtschaftskriese. Der durchschlagende Erfolg Hitlers in der Arbeitsbeschaffung und der erklärte Kampf gegen den Bolschewismus beeinflussten die Rezeption des aufsteigenden Dritten Reiches. Man erinnert sich: Die Zwanzigerjahre waren in der Schweiz ebenfalls geprägt von scharfen politischen Grabenkämpfen und der Angst vor einem drohenden bolschewistischen Umsturzversuch. Die demagogischen Reden, die über Radio und die Wochenschauen die Schweiz erreichten, verfehlten auch hierzulande teilweise ihre Wirkung nicht. Der Schweizer Grenzgänger merkte, dass es besser war „ufs Muul z’hocke“. Schülerbeziehungen brachen auseinander, die Besuche wurden eingeschränkt, später aufs Notwendigste beschränkt. In den Wirtschaften war es ratsam, sich zurückhaltend auszudrücken. Das Wort „Schutzlager“, eine perfide Wortverdrehung für eine willkürliche Freiheitsberaubung, wechselte man hinter der vorgehaltenen Hand. Badenser, die sich kritisch zum neuen Regime einstellten, waren durch sie bedroht. Das Fridolinsfest in Säckingen fand je länger je mehr ohne Schweizer Beteiligung statt. Für die Wallfahrt nach Todtmoos verlangten die Behörden bereits 1933 eine Liste der teilnehmenden Schweizer mit ihren Geldbeträgen. In der Kirche merkte man die vorsichtige Zurückhaltung der deutschen Geistlichen aus Angst vor Spitzeln. Parteigänger in Zivil kamen anfänglich noch ungeniert in die nahen Wirtshäuser auf Schweizerboden, ihre Parteizeichen als Erkennungszeichen unter dem Revers versteckt, und machten Stimmung für Deutschland. Diese Entwicklung bestimmte die Dreissigerjahre im Grenzraum. Immer mehr Fricktaler erlebten, wie jenseits der Grenze die einen freiwillig oder mit an Fanatismus grenzendem Eifer mitmachten, wie andere sich schlicht anpassten und erkannten, mit welch undemokratischen Methoden ablehnende Badenser eingeschüchtert und linienkonform gemacht werden sollten. Eine vorentscheidende Wirkung hatten zweifellos die Ereignisse um Österreich. Der Anschluss fand überall in der Eidgenossenschaft ein enormes Echo. Der Einmarsch in Österreich brachte viele, noch zweifelnde Leute zur Einsicht, dass Adolf Hitler und seiner Politik nicht zu trauen ist. Das Schicksal des Nachbarstaates erregte die Gemüter. Die Neue Aargauer Zeitung brachte die Stimmung auf den Punkt, als sie im März 1938 vorausschauend schrieb: „Es kann nach dem Fall Österreichs kein vernünftiger Mensch mehr zweifeln, wie sich Hitler den Schutz der 10 Mio Deutschen denkt, die in zwei an Deutschland grenzenden Staaten leben. Die Tschechoslowakei wird das Opfer Nr. 2 dieses Schutzes sein.“ Im Herbst 1838 steigerte sich die politische Spannung beträchtlich. (…) an der Gefährlichkeit Hitlers gab es keine Zweifel mehr. Die geistige Landesverteidigung setzte ein. In der Presse wurde unfreundlichen, bisweilen frechen und provozierenden deutschen Äusserungen ein eidgenössisches Wort entgegengehalten. Auch die Aargauische Presse verwahrte sich gegen diese Art „Brunnenvergiftung“ deutscherseits. Der gemeinsame Nenner in der jahrzehntelangen Zeit der Grenzbeziehungen war verschwunden und schien ersetzt durch unverhohlene Einverleibungsgelüste. Der Fricktal-Bote titulierte die Besetzung der Tschechoslowakei nunmehr als „brutale Überrumpelung“ und sprach vom „NS-Imperialismus“. Das endgültige Verschwinden der Tschechoslowakei von der Europakarte im Frühjahr 1939 bildete die Signalwirkung in der ordentlichen Meinung schlechthin. Hitler war entlarvt. (…) Am 26. August 1939 empfahl der Fricktal-Bote seinen Lesern mit mahnenden Worten: „Wehrpflichtige, haltet Euch bereit!“ (Quelle: Vom Jura zum Schwarzwald).
Der Rheinfelder Autor Manfred Bosch veröffentlichte im Südkurier-Verlag 1985 eine Dokumentation über Verweigerungen, Widerstand und Verfolgung im Dritten Reich auf dem Hotzenwald. Der Titel des Buches: „Als die Freiheit unterging“. Immer wieder erscheinen in den Dokumenten und Briefen aus dieser Zeit, die Bosch veröffentlichte, auch Pfarrer, die unerschrocken von der Kanzel gegen die Nationalsozialisten wetterten. Im Gegensatz zu den Kirchenleitungen spürte die klerikale Basis früh, dass das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 über die Ausübung des Glaubens kein ausreichender Schutz sein würde. Viele Pfarrer waren einfach nicht bereit, sich Wohlverhalten aufzwingen zu lassen. In einem langen Brief des zuständigen badischen Ministeriums vom Dezember 1933 wird das „Wiederaufleben der politischen Tätigkeiten und insbesondere der feindseligen Äusserungen und Handlungen der katholischen Geistlichen gegenüber der national-sozialistischen Bewegung“ im Detail und mit Namen geschildert. Erwähnt ist darin auch der katholische Herrischrieder Pfarrer Rombach. Er soll demnach schon im August 1933 das Jungvolk der Hitlerjugend als „Jungvieh“ bezeichnet haben. Ein weiterer, der von der Kanzel wetterte, war auch der Pfarrer von Todtmoos. Ein Zitat aus „Der Kampfzeit des Sturmbann III/142“, in: „Der Alemanne“, 11, März 1934, schildert eindrücklich eine seiner Predigten aus nationalsozialistischer Sicht: „Als der Tag sich jährte, an dem unser Kamerad Leo Schwald gestorben war, prägte sich den SA-Männern in Todtmoos ein Bild ein, das wohl zeitlebens nicht mehr aus ihren Herzen verwischt werden kann. Denn als der Geistliche von Todtmoos die Hakenkreuzschleife am Kranze sah, begann er eine derartige Hetzkampagne gegen die Partei, dass es sogar den Bauern beinah zu bunt wurde. Dieser sogenannte Seelsorger entblödete sich nicht, die Kanzel zu missbrauchen, um den verhassten Nazis die Hölle heiss zu machen, Dieser Politiker im geistlichen Gewande benutzte seine Stellung dazu, um auf diese schändliche Art und Weise seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen …“
Im Wissen darum, dass es in der badischen Nachbarschaft nicht nur Mitläufer und Anpasser gab, darf man aber auch erfahren, dass die vom Krieg verschonten Fricktaler nicht bloss Zuschauer des Dramas waren. In Tat und Wahrheit wurde auch die Schweiz von den Ereignissen schwer getroffen. Untergang und Verwüstung blieben dem Kleinstaat zwar erspart, doch brachten die Jahre der lauernden Bedrohung und der Erpressung für eine ganze Generation Nöte, Lasten und Entbehrungen. Die Fricktaler erlebten die Zeit des Aktivdienstes besonders eindrücklich. Während Jahren war der Alltag in den Ortschaften am Rhein und in den Juradörfern geprägt von der Präsenz der Grenztruppen. Väter und Söhne waren mobilisiert, und Frauen und Kinder, die daheim in die Lücke zu springen hatten, leisteten ihren Beitrag oft bis zur Erschöpfung. Die Anwesenheit der Truppe, mit der man in einem guten Verhältnis stand, schuf Vertrauen und minderte die Furcht vor der Bedrohung. Dies rückte die Fricktaler näher an den demokratischen Staat (Eidgenossenschaft), dem sie einst zugeordnet worden waren, während die Bindungen an die alten Nachbarn ennet dem Rhein abrissen. Den Zusammenbruch des Dritten Reiches empfand man hier als Befreiung. Siegesfreude war fehl am Platz. Mitleid mit der hungernden Bevölkerung und alte Bindungen, denen die Jahre des Schreckens nichts anhaben konnten, schufen gute Voraussetzungen, um sich in einem besseren, freien Europa, wieder freundnachbarlich zu begegnen (Quelle: Vom Jura zum Schwarzwald, 1989).
Der Kriegsausbruch
Mit dem Kriegsausbruch wurde das wohl einzigartige, gutnachbarliche Einvernehmen zwischen den Fricktalern und der badischen Nachbarschaft nachhaltig gestört. Zwar hatten sich schon seit der Machtergreifung der NSDAP (1933) tiefe Risse aufgetan, doch nun gab es für die Dauer des Krieges praktisch keine Gemeinsamkeiten mehr. Nur das Wissen um die erdrückenden Lebensbedingungen unter der Nazidiktatur ermöglichte nach dem Kriegsende die Wiederaufnahme freundschaftlicher Beziehungen.
Auf den Kriegsausbruch im September 1939 war die Schweiz besser vorbereitet als ein Vierteljahrhundert zuvor. Um einen möglichen deutschen Angriff abzuwehren, deckte die 5. Division den Aargauer Grenzraum ab und besetzte Stellungen im Jura, entlang dem Rhein und an der Limmatlinie. Lebensmittel waren von Kriegsbeginn an rationiert. Im Rahmen der «Anbauschlacht» konnte im Aargau das Ackerland durch Rodungen, Meliorationen und Umnutzung von Rasenflächen um 113 % erweitert werden. 1945 machten die Ackerflächen 42 % des Kulturlandes aus, gegenüber 23 % bei Kriegsbeginn. Um den Import dringend benötigter Rohstoffe weiterhin zu ermöglichen, war die Schweiz zu wirtschaftlicher Kooperation mit den Achsenmächten gezwungen. Aargauer Kraftwerke lieferten Strom nach Deutschland, die Alliierten führten zahlreiche Aargauer Unternehmen (allen voran die Brown, Boveri & Cie.) auf schwarzen Listen.
Ab 1940 lebten in 19 Lagern auf Kantonsgebiet rund 2000 internierte polnische Soldaten. Diese wurden in der Landwirtschaft und beim Strassenbau eingesetzt. Ein solches Lager befand sich auch im Gebiet «Unter Sonnenberg», im Grenzbereich zwischen Zeiningen und Möhlin. Ende April 1945 drängten mehrere Tausend deutsche Flüchtlinge über die Grenze, worauf man sie in Lagern unterbrachte. Zurückweichende Wehrmachtsoldaten führten Befehle, die Rheinkraftwerke zu sprengen, nicht aus.
Höhepunkt der Bedrohung
Am 9. Dezember 1939 wurden Landwehr- und Landsturmsoldaten entlassen. Der Auszug musste weiterhin bauen und bewachen. Während des Winters bereitete sich die deutsche Wehrmacht für den Angriff 85 nach Westen vor. Am 6. März 1940 wurden die Grenzbrigaden wieder mobilisiert. Am 9. April wurden Dänemark und Norwegen überfallen. Die Ereignisse überstürzten sich. Als Reaktion auf den deutschen Angriff auf Holland, Belgien und Frankreich am 10. Mai wurde in der Schweiz die 2. Mobilmachung angeordnet. Unsere Wachen am Rhein wurden Zeugen einer grossen militärischen Hektik auf der deutschen Seite: Endlose Truppentransporte, nächtliches Herumfahren von Panzern, Bereitstellung von Artillerie, Pontonier- und Brückenmaterial, provokantes Auftreten von deutschen Offizieren an der Brücke von Säckingen. Diese Beobachtungen wurden ergänzt durch eine Flut von Gerüchten und Informationen der Geheimdienste. Auch der Besuch des Generals bei der Truppe und in Laufenburg wies auf den Ernst der Lage hin. Als am Abend des 14. Mai das 2. Armeekorps in Alarmbereitschaft versetzt wurde, erwartete man den deutschen Überfall in der kommenden Nacht. – Im Nachhinein entpuppte sich die deutsche Betriebsamkeit nahe unserer Grenze als grosser Bluff. Deutschland täuschte die Absicht einer südlichen Umgehung der Maginot-Linie durch die Nordwestschweiz vor, um Frankreichs Truppen im Raum Basel-Metz zu binden und zu verhindern, dass ihnen diese beim Vorstoss im Norden in die Flanke fallen.
Das Réduit
Am 10. Juni 1940 erklärte Italien den Alliierten den Krieg. Am 22. Juni kapitulierte Frankreich. Die Schweiz war durch die Achsenmächte eingeschlossen und es begann die Gratwanderung zwischen Neutralität und Sicherstellung der Landesversorgung. Mit dem berühmten Rütlirapport vom 18. Juli 1940 führte der General die Strategie des «Réduit national» ein. Der Rückzug des Grossteils der Armee ins Alpengebiet brachte für Zeiningen eine Entlastung. Zwar hatten die Wehrmänner nach wie vor längere Dienstzeiten zu leisten, aber die Belastung durch Einquartierungen nahm spürbar ab. Viele Stacheldrahtverhaue in Wald und Feld wurden entfernt.
Die Ortswehr
Im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung wurde 1943 die Ortswehr geschaffen. Sie rekrutierte sich aus freiwilligen Burschen im Alter von 18 Jahren bis zur Rekrutenschule und aus dienstuntauglichen Männern im wehrfähigen Alter. Anfänglich mussten sie ihre persönliche Waffe (irgendeine alte Flinte aus dem Familienbesitz!) selber besorgen. Später erhielt man vom Kanton einige Karabiner. Ohne spezielle Ausbildung erhielten die Ortswehrler einige Lader scharfe Munition und wurden zeitweise zur Bewachung von Objekten befohlen. In besonders kritischen Zeiten machten sie auch Strassenkontrollen.
Die einschneidendste Änderung – abgesehen von den Einquartierungen – war die Abwesenheit der dienstpflichtigen Männer, die nun in der Landwirtschaft und im Gewerbe fehlten. Da zusätzlich auch die meisten Pferde requiriert worden waren, standen die Frauen vor einer enormen Herausforderung. Die durch die Truppe angebotene Hilfe konnte zwar über die schlimmsten Engpässe bei Heuet oder Kirschenernte hinweghelfen. Die täglichen Verrichtungen in Feld und Stall lasteten aber trotzdem weitgehend auf den Frauen. Der im Januar 1940 eingeführte Lohnausgleich für Militärdienstleistende sowie spezielle Hilfskassen halfen, die finanzielle Not der Familien zu lindern.
Evakuationsvorbereitungen
In den am meisten gefährdeten Gebieten des Landes wurde die Evakuation der Zivilbevölkerung vorbereitet, so auch in Zeiningen. Der entsprechende Erlass vom Oktober 1939 wurde in einer neuerlichen Weisung des Bundesrates im Februar 1940 bestätigt (Quelle: ETH-e-periodica): „Sie wurde von vielen Kantonen, so auch im Aargau, zusammengefasst und der Bevölkerung mitgeteilt. Die folgenden vier Hauptpunkte können festgehalten werden:
- Eine militärisch befohlene Evakuation war nur im absoluten Notfall vorgesehen. Die Bevölkerung hatte sich in Zeiten erhöhter Kriegsgefahr sowohl zum Verbleib am Wohnort als auch auf das sofortige Verlassen der Gemeinde vorzubereiten.
- Die freiwillige Abwanderung vor Kriegsbeginn war erlaubt, erfolgte aber auf eigene Gefahr, Kosten und Verantwortung. Es musste ausserdem damit gerechnet werden, dass diese von der Armee plötzlich unterbunden werden könnte.
- Der Kanton Aargau hatte keine behördliche Organisation zur freiwilligen Abwanderung vorgesehen, da für allfällig gefährdete Gemeinden von militärischer Seite die nötigen Anordnungen getroffen wurden.
- Ausserdem wurden die Informationen aus dem Haushaltungs-Marschbefehl zusammengefasst.
Aus Nachforschungen von Eugen Kaufmann geht hervor, dass die Grenzorte Kaiserstuhl, Zurzach, Koblenz, Full, Laufenburg, Mumpf, Zeiningen und Magden zur sofortigen Evakuation im Kriegsfall vorgemerkt waren. Dies wohl deshalb, weil sie an einem wichtigen Rheinübergang und in der eigenen Abwehrfront beziehungsweise der gegnerischen Feuerlinie lagen. (….).“
Wirtschaftliches
Schon vor Beginn des Krieges hatte die Arbeitslosigkeit etwas nachgelassen. Nach der Mobilmachung fehlte es in Landwirtschaft und Gewerbe überall an Arbeitskräften. Zwar wurde für die dringendsten Arbeiten grosszügig Urlaub gewährt, allerdings auf Kosten derer, die keinen dringenden Bedarf nachweisen konnten und somit über längere Zeit im Felde ausharren mussten. Obwohl das Wetter in den Kriegsjahren für die Landwirtschaft günstig und die Ernten gut waren, gab es Probleme. In den Rebbergen war die Reblaus immer noch nicht besiegt. Im Fricktal wütete mehrmals die Maul- und Klauenseuche und als neuer Schädling etablierte sich der Kartoffelkäfer (Koloradokäfer), dessen Larven die Kartoffelstauden kahlfrassen. Das von der Firma Geigy 1941 auf den Markt gebrachte Kontaktinsektizid Gesarol (DDT) kam gerade zur rechten Zeit und wurde mit Erfolg und ohne Bedenken gegen den neuen Schädling eingesetzt. Am Wirtshaustisch wurde allerdings behauptet, die chemische Industrie habe den Koloradokäfer importiert, um dann das Gift verkaufen zu können (Verschwörungstheorie!). Auch gegen die Mäuseplage wurde erstmals chemisch vorgegangen.
Kriegsende
Die deutsche Niederlage im Russlandfeldzug war der Anfang vom Ende des «Tausendjährigen Reiches». Mit der Ardennenoffensive scheiterte im Dezember 1944 Hitlers letzter Versuch, das Schicksal nochmals zu wenden. Um die Jahreswende 1944/45 beobachteten unsere Grenzwachen, wie jenseits des Rheins Befestigungsanlagen entlang der Schweizer Grenze gebaut wurden, vermutlich aus Furcht, die Alliierten könnten von der Schweiz her eine zusätzliche Front eröffnen. Manche Zeitzeugen erinnern sich noch gut an die vielen Luftverletzungen durch alliierte Bomber, die seit September 1944 das deutsche Verkehrsnetz sowie die Kriegsindustrie lahm zu legen versuchten. Die Bombardierungen von Säckingen, Albbruck und Waldshut haben bei denen, die sie beobachteten, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dass gelegentlich Bomben auf Schweizer Boden niedergingen, schrieb man mangelnden Geografiekenntnissen der Amerikaner zu.
In der Grenzregion entlang des Rheins befürchtete man, die Deutschen könnten auf ihrem Rückzug nach dem Prinzip der verbrannten Erde verfahren. Seit Februar 1945 waren Brücken und Stauwehre durch deutsche Pioniertruppen zur Zerstörung vorbereitet worden. Man befürchtete, eine Flutwelle könnte im Extremfall das Rheintal verwüsten. Geschicktes und mutiges Handeln einzelner Personen auf beiden Seiten des Rheins halfen, weiteres Unheil zu verhindern. So wurde z.B. das Zündsystem im deutschen Teil des Kraftwerks Laufenburg von schweizerischen Kraftwerkangestellten knapp vor dem Einmarsch der Franzosen entfernt, nachdem man zuvor die Wachmannschaft mit Stumpen bestochen und damit ihr wohlwollendes Wegsehen erkauft hatte! Das Kraftwerk Rheinfelden wurde durch ein Ad-hoc-Komitee, dem auch Schweizer Rheinfelder angehörten, vor der vorgesehenen Zerstörung bewahrt. In Erwartung einer nicht beherrschbaren Flüchtlingswelle verfügte der Bundesrat am 13. April 1945 die Schliessung der Nordgrenze zwischen Basel und Altenrhein. Nur wenige Übergänge blieben offen, darunter Rheinfelden. Nach einer Vereinbarung zwischen der Schweiz und den lokalen deutschen Behörden wurde ab dem 21. April der Flüchtlingsstrom über die Rheinbrücke geleitet. Während der folgenden vier Tage passierten 3029 Flüchtlinge und 61 Deserteure. Deutschen Flüchtlingen wurde der Übertritt jedoch verweigert. Flüchtende Kriegsgefangene aller europäischen Nationen, russische Zwangsarbeiter, oder in Deutschland lebende Schweizer wurden auf dem Inseli registriert und anschliessend in die alte Saline gebracht, welche schon seit einiger Zeit als Auffang- und Quarantänelager für fremde Menschen diente. Dass die 2602 Russen, die in diesen Tagen über Rheinfelden und einige andere Übergänge in die Schweiz flüchteten, nach ihrer Rückkehr nach Russland als Kollaborateure angesehen und umgebracht wurden, war eine der vielen menschlichen Tragödien, die auch unsere Region berührte. Am 25. April war es so weit: Französische Panzertruppen besetzten Städte und Dörfer jenseits des Rheins. Widerstand gab es kaum mehr. Mit weissen Fahnen signalisierten die Bewohner ihre Kapitulation. Kompromittierendes Material war bereits verbrannt oder in den Rhein geworfen worden. Am 8. Mai erfolgte die deutsche Kapitulation. Die Menschen konnten aufatmen.
Episoden und Erinnerungen aus dem Fricktal und aus Zeiningen
„Die Kriegszeit prägte die Generation, die jahrelang im militärischen Einsatz stand, wesentlich. Bis heute noch erzählen Veteranen gerne aus ihrer Aktivdienstzeit. Neben nachdenklich stimmenden Episoden sind viele anekdotische und legendenumwobene Erlebnisse überliefert. In der Grenzregion spielten sich über die Rheinbrücken hinweg oft provokative Wortgefechte ab. Im Dezember 1939 waren die im Ausbau befindlichen Grenzbunker auf Schweizer Seite westlich von Laufenburg mit Sacktuchwänden gegen Sichtkontakt geschützt. Auf die Packleinwand hatte ein Witzbold gekonnt einen riesigen Eselskopf mit der typischen, in die Stirn fallenden Hitlerlocke gemalt. Deutsche filmten diese für sie höchst anstössige Darstellung, die zu einem diplomatischen Nachspiel wegen «Führerbeleidigung» führte. Bern sah sich gezwungen, zu diesem Sachverhalt eine Untersuchung anzuordnen, die jedoch erwartungsgemäss keine Ergebnisse zeitigte. An Weihnachten 1939 stellten Deutsche einen Eimer voll Kuhdreck «für die Kuhschweizer» auf die Mitte der Zurzacher Brücke. Diese antworteten mit einem Kübel voll Butter mit der Widmung: «Unseren deutschen Freunden - jeder gibt, was er hat.» Aber auch ungezwungene und vertrauliche Kontakte ergaben sich über den Rhein hinweg. Als ob kein Krieg herrschte, kam ein deutscher Grenzwachtmeister fast täglich von Säckingen über die Rheinbrücke nach Stein, um hier Kaffee einzukaufen oder sich einen Feierabendschoppen zu genehmigen“ (Quelle: „Die Zeit der Weltkriege – Historische Gesellschaft des Kantons Aargau“).
Am 28. August 1939 bot der Bundesrat den Grenzschutz auf. Die entbehrungsreiche Zeit der Grenzbesetzung hatte begonnen. Zeiningen glich eher einem Heerlager. Es beherbergte zeitweise mehr Soldaten als Einwohner. Das Zusammenleben mit der ansässigen Bevölkerung war problemlos. Die Truppe wurde geschätzt und erhielt alle erdenkliche Hilfe bei der Beschaffung von technischem Material etc. Freundliche Aufnahme in den Stuben der Zivilen – ab und zu bei einem Kaffeefertig - half über manche Krise hinweg. Um die Weihnachtszeit gab der Kirchenchor in der Taube ein Konzert. Umgekehrt griffen die Soldaten helfend ein, wo als Folge der Mobilmachung in der Landwirtschaft und im Kleingewerbe die männlichen Arbeitskräfte fehlten. Strategisch geriet unsere Gegend ins Zentrum des Interesses, weil man eine deutsche Umgehung der Maginot-Linie durch die Schweiz befürchtete. Für diesen Fall wurde mit dem französischen Generalstab heimlich vereinbart, dass die franz. Armee die Lücke zwischen Hüningen und Gempen schliessen und unsere Armee zwischen Basel und Olten ablösen solle. Nach einer Besichtigung der Verteidigungsstellungen verlangte der franz. Oberstlt. Garteiser die Verstärkung der Befestigungen in unserer Region, was mindestens teilweise ausgeführt wurde (Bunker und Befestigungen auf beiden Talseiten, Panzer-Barrikaden, etc.). Ein Bauwerk aus dieser Zeit ist in Zeiningen noch gut ersichtlich (vgl. auch Zeininger Schäsli 1999), die grosse, mächtige Mauer zwischen dem Kirchweg und dem Winkelgässli. Aus heutiger Sicht macht dieses Bauwerk weder militärisch und schon gar nicht ortsbildschützerisch Sinn. Es war wohl eher als Beschäftigungstherapie der damals in unserem Dorf stationierten Gz Füs Kp III/243 gedacht. Wie oft bei Bauwerken grösseren Ausmasses üblich, verewigten sich auch die strammen Mannen der Baselbieter Gz Füs Kp durch eine entsprechende Inschrift. Neben der Kompanie-Bezeichnung und dem Jahrgang (1940) enthält sie nämlich auch das Wappen des Heimatkantons dieser ehemaligen Kompanie, den Baslerstab.
Ein Flugzeugabsturz
Zwischen Zeiningen und Zuzgen stürzte 1945 ein amerikanischer Bomber ab. Nachstehend die interessante Beschreibung dieses Tages durch die Flugzeugbesatzung (Quelle: ETH-e-periodica): „Auszüge aus dem zunächst geheimen Bericht über die Einvernahme der drei Schneiderabgesprungenen und später festgenommenen Besatzungsmitglieder (die Einvernahme wurde am 17. April 1945 auf dem Kommandoposten der Fliegerabwehr des Regiments 25 durchgeführt): Einflug und Fallschirmabsprung in der schweiz. Am 16. April 1945 führten die mittelschweren Bombardierungsverbände der 9. Amerikanischen taktischen Luftwaffe einen strategischen Angriff gegen die Bahnhofsanlage in Kempten (Bayern) durch. An diesem Angriff nahm auch die einvernommene Besatzung teil. Infolge Motorausfalls aufgrund technischer Probleme erreichten sie ihr Ziel jedoch nicht. Südlich Ulm mussten sie ihre Bomben im Notwurf fallen lassen. Sie versuchten darauf allein auf ihren Stützpunkt St. Quentin (Frankreich) zurückzufliegen. Irgendwo im nördlichen Schwarzwald gerieten sie in ein heftiges Feuer der schweren deutschen Flak, wodurch ihr rechter Motor einen Volltreffer erhielt. Der ganze Motor wurde weggerissen, der Propeller in Folge der Explosion in die Seitenwand des Flugzeuges geschleudert. Der Hilfspilot wurde durch die Explosionskraft zurückgerissen. Sämtliche Navigations- und Flugüberwachungsgeräte wurden durch den Propeller zerstört. Neben dem Hilfspiloten, welcher einige Sekunden bewusstlos war, hatte niemand von der Besatzung Schaden genommen. Durch die sehr starke Beschädigung des Flugzeuges wurde auch das Seitensteuerkabel abgerissen, sodass auch die Seitensteuerung ausfiel. Ohne Kompass, ohne sonstige Navigationsmittel und ohne Karten versuchten sie rein nach Schätzung des Sonnenstandes die allgemeine Westrichtung einzunehmen. Das Flugzeug verlor ständig an Höhe. Eine Notlandung im gebirgigen Schwarzwald war zu riskant. Mit knapper Not kamen sie über eine Hügelkette, als sie dahinter den Rhein erkannten. Sie versuchten durch Überfliegen des Rheines französisches Gebiet zu erreichen. Der Pilot gab daher sofort durch eine Alarmglocke den Absprungbefehl. Zwei Mann der Besatzung sprangen so schnell hinaus, dass sie noch auf deutschem Gebiet niedergingen. Der restliche Teil der Besatzung verliess in regelmässigen Abständen das Flugzeug. Der Fallschirm des Piloten, welcher als letzter aus dem Flugzeug absprang, öffnete sich nicht mehr. Er wurde an seinem Fallschirm hängend tot aufgefunden (beim Chilleplatz in Zeiningen, Anm. Zeguhe). Nach dem Zeitpunkt des Kriegsendes befragt, ist die Besatzung der Ansicht, dass der Krieg noch zwei bis drei Monate dauern wird, da sich die Kämpfe im gebirgigen Gelände Südbayerns und Österreichs bedeutend schwieriger gestalten werden, wie dies in den jetzigen Kampfräumen der Fall ist. Oberleutnant J.R. Léger.
Bekanntlich hat der Krieg nicht mehr so lange gedauert, wie die Besatzung annahm. Schon drei Wochen später war am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende. Helmut Wachter.“
Ein 2020 verstorbener Augenzeuge berichtete: „Aus etwa 200 m Distanz konnte Landwirt Emil Sacher aus Zuzgen, zusammen mit seinem Cousin auf dem Chriesiberg mit Pferd und Pflug einen Kartoffelacker bestellend, den Absturz des B-26-Bombers beobachten. Er berichtet, dass sie den Flab-Beschuss von der Möhliner Höhe her wohl gehört, diesen Geräuschen aber keine Beachtung geschenkt hätten, da es während des Krieges immer wieder zu solchem Geschützlärm kam. Kurze Zeit später hörten sie, wie von Zeiningen her das Flugzeug herangebrummt kam.“
Zu diesem Ereignis hat Meinrad Hohler im Zeininger Schäsli 1999 (er war damals Gemeinderat) folgendes berichtet: „Ebenfalls vom zweiten Weltkrieg handelt die folgende Geschichte: Wallace Lundgren sei sein Name. Fast 80 Jahre alt und wohnhaft in Elgin, Texas, Amerika – so, fast ein bisschen kaltschnäuzig, meldete sich der grossgewachsene, hagere Mann an einem heissen Sommertag des letzten Jahres (1998) auf der Gemeindekanzlei. Er habe damals, 1945, einen Bomber der gleichen Staffel pilotiert, von denen einer getroffen wurde, sich jedoch noch in die neutrale Schweiz retten konnte und in der Gegend von Zeiningen abstürzte. Er möchte den Ort sehen, an dem einer seiner engsten Kriegskameraden tödlich verunglückte. Also begleitete ich Wallace auf dem letzten Abschnitt seines langen Weges von Elgin, Texas USA nach Zeiningen auf der Suche nach Menschen, Orten und Spuren, die an dieses tragische Ereignis erinnern könnten. Schon beim Burgackerhof wurden wir fündig, konnte uns doch aus erster Hand eine Episode im Zusammenhang mit diesem Bomberabsturz von damals erzählt werden: Ein Mitglied der Besatzung des abstürzenden Bombers ging damals mit seinem Fallschirm ganz in der Nähe des Hofes resp. auf dem Feld, auf dem die Familie Freiermuth gerade am „Heuen“ war, nieder. Freiermuth’s gaben sich gastfreundlich, luden den vom Himmel gefallenen Gast in die gute Küche ein und offeriertem ihm Spiegeleier. Genau in dem Moment, als er diese verzehren wollte, erschien ein Hauptmann der Schweizerarmee und befahl dem nun plötzlich zum Gefangenen gewordenen Amerikaner das Spiegeleieressen gefälligst sofort zu unterlassen und ihn auf den Kommandoposten zu begleiten. Der Hauptmann hatte aber seine Rechnung ohne die resolute Gastgeberin gemacht. Erst als der amerikanische Soldat genüsslich die ihm herrlich mundenden Spiegeleier verzehrt hatte, liess sie es zu, dass der stramme Herr Hauptmann zu seiner Tat schreiten konnte.“
Rückbau eines Bunkers im Herzen von Zeiningen, 2020
Eine weitere Story über militärische Anlagen und Geschehnisse in Zeiningen während des Zweiten Weltkrieges konnte der Neuen Rheinfelder Zeitung vom 14. Mai 2020 entnommen werden. Die Korrespondentin, Janine Tschopp, berichtet (quasi in eigener Sache) über den in der letzten Woche in ihrem Privatgarten entfernten militärischen Bunker. Ihr Schwiegervater, der 87-jährige Zeininger Bruno Tschopp, habe aus seinen Erinnerungen über die Entstehung dieses Werkes folgendes erzählt: „Ursprünglich wollten sie den Bunker mitten im Garten bauen, am schönsten Ort. Als mein Vater am Wochenende vom Dienst heimkam wehrte er sich“. Schliesslich platzierte das Militär den Schutzbau aus Beton am äussersten Rand des privaten Gartens. Relevant war die Schussrichtung gegen das Mitteldorf. „Weil sie in der Schussrichtung standen, hat das Militär zwei grosse Silbertannen von der Metzgerei gefällt, ohne jemanden zu fragen. Den Metzger freute das gar nicht.“ Eine weitere Begebenheit während des Zweiten Weltkriegs, an die sich Bruno Tschopp noch gut erinnert: „Tag und Nacht hielten Soldaten vom Bunker aus Wache. Zwischendurch schossen sie mit Leuchtspurmunition, zu Übungszwecken“ (evtl. auch aus Langeweile). Besonders spektakulär war für den kleinen Buben damals, dass er manchmal zu den beiden Soldaten im Bunker hinunterklettern durfte. „Das Essen bekamen die Soldaten jeweils von der Militärküche, die auf dem Turnhalleplatz positioniert war. In Zeiningen hatte es viele Soldaten zu dieser Zeit.“ - Mittlerweile hat Bruno Tschopps Sohn Martin das Haus übernommen und den Bunker mit einer Grundfläche von zirka 36 Quadratmetern und einer Höhe von 3.6 Metern entfernen lassen. Der Beton war stark armiert; insgesamt wurde etwa eine Tonne Eisen abgeführt. Martin Tschopp und seine Tochter Linda freuen sich, „nun haben wir plötzlich ganz viel Platz im Garten“. Grossvater Bruno Tschopp findet es auch gut, dass der „Hübel“ weg ist. Seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg bleiben ihm auch ohne das Denkmal im Garten. An das Kriegsende mag er sich noch gut und gerne entsinnen: „Die Kirchenglocken läuteten und Karl Gremper, ein Mann aus dem Dorf, kam zu uns Kindern auf den Schulhausplatz und sagte „Buebe, jetz isch dr Chrieg fertig.“ Das war am 8. Mai 1945, genau 75 Jahre, bevor der historische Schutzbau aus dem Herzen von Zeiningen verschwand.“